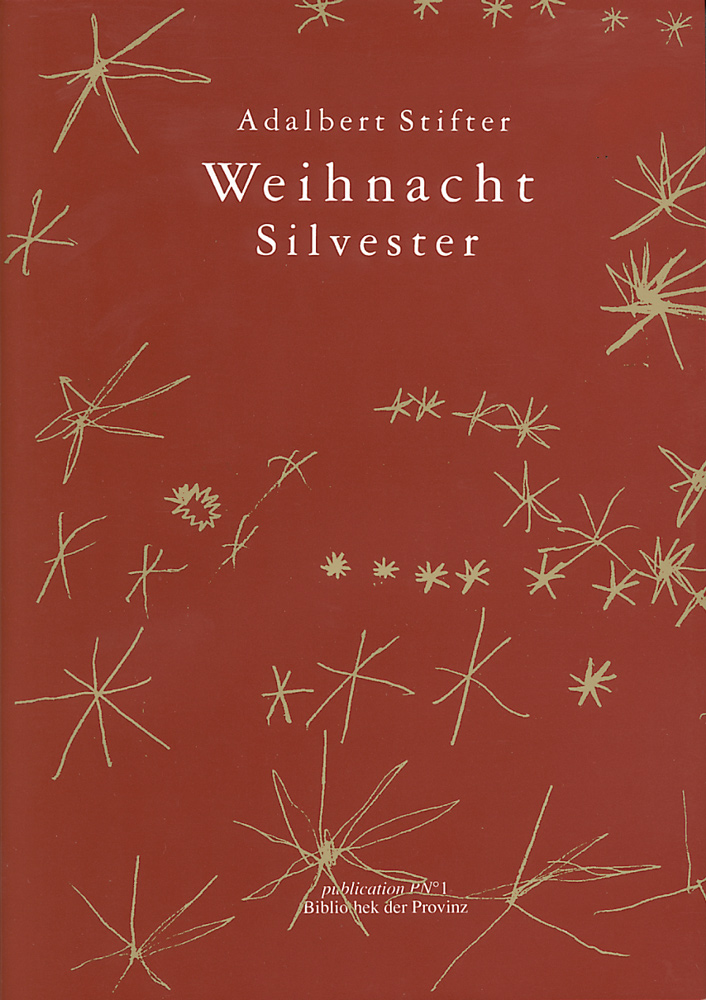
Weihnacht | Silvester
Adalbert Stifter, Richard Pils
ISBN: 978-3-900878-89-4
21 x 15 cm, 40 Seiten, Hardcover m. Schutzumschl.
11,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
WEIHNACHT
Soweit Aufzeichnungen und Erinnerungen zurückreichen, haben Menschen und Völker ihre heuigen Feste gehabt, an denen sie ihre Seelen in nähere Beziehung zu den Wesen setzten, die sie über sich glaubten, als Herren ihres Schicksals, mit großer, oft unbegrenzter Macht ausgerüstet, mit Gaben versehen, die unbegreiflich sind, und den Willen hegend, auf die Menschen mannigfach einzuwirken, sie mochten nun diese Wesen Götter oder Selige oder Himmlische oder wie immer heißen.
Und ein Schein und ein Schimmer war gewiß zu allen Zeiten für sinnige Gemüter durch Herz und Natur bei diesen Festen ausgegossen, wenn auch nicht alle, ja vielleicht die wenigsten Ursprung, Zweck, Bedeutung und Inhalt der Feste erkannten und wenn sie vielmehr ihre eigenen frommen oder dichterischen oder einbildungsvollen Gedanken mit dem Feste verbanden. Und als das Licht des reineren Glaubens in die Welt gekommen war, haben die Feste nicht aufgehört; sie sind heiliger geworden, und ein Schein und ein Schimmer ist durch Herz und Natur bei ihnen ausgegossen, wenn die Menschen sich mit ihren Ahnungen in das Wesen des Festes versenken und wenn sie kleine Verzierungen und kleine Zutaten je nach den Wallungen und Pulsschlägen ihres Lebens beifügen.
Und ganze Abschnitte des Jahres bezeichnen solche Feste, und wie Lichtsäulen stehen sie auf den Zinnen der Zeit. Das Christentum hat mehrere seelenerhebende Feste. Und ist Pfingsten das „liebliche" Fest und ist Ostern das erhabene, so ist Weihnacht das herzinnige. Es ist das Fest des Kindes, des ewigen, des heiligsten, des allmächtigen, des liebreichsten Kindes, des Königes der Kinder.
In einer Nacht ist dieses Kind auf einer ärmlichen Stelle geboren worden und hat die Gestalt des Menschen angenommen, und diese Nacht wird jetzt von einer ganzen Welt gefeiert und heißt die Weihnacht, die Nacht der Weihe, die von nun ab über die Völker ausgebreitet worden ist.
Und wie in jener Zeit, ehe das Kind geboren worden ist, die Welt auf den Erlöser harrte, der die finstern Übel, die da brüteten, hinwegnehmen sollte, und wie uns gesagt wird, daß die Menschen gerufen haben: „Himmel, tauet ihn herab", was in der römischen Sprache rorate hieß, so bereitet sich die Kirche durch ein monatlanges Fest, das Ankunftsfest, Advent, zu dem Geburtsfeste des Kindes vor, und der Priester der katholischen Kirche hält Meßopfer, die Rorate heißen, und die bis zu dem ersehnten Tage dauern …
Rezensionen
Willibald Feinig: Toast auf das Jahr 2013, nach StifterMan meint, schreibt Stifter unter dem Titel „Der Silvesterabend“ anno 1866, was sich messen, was sich unterteilen lässt, sei wirklich; und so setzen wir einen Jahresanfang und ein Jahresende fest, wir rekapitulieren, was in den vergangenen 365 Tagen – mehr oder weniger – à 24 Stunden (oder eine mehr oder eine weniger) geschehen ist, und wünschen, was die so erzeugte „Zukunft“ bringen soll, und mutmaßen, was sie bringen wird. „Man tappt sich an der Zeit hin wie am Raume … In Wirklichkeit hat das Jahr nicht irgendwo seinen Anfang und sein Ende.“
„Die Zeit“, schreibt Stifter anno 1866, „ist das Geheimnis der ganzen Schöpfung. Wir sind in sie eingehüllt, kein Pulsschlag, kein Blick der Augen, kein Zucken einer Fiber ist außer ihr. Wir können nicht aus ihr heraus und wissen nicht, was sie ist.“ Wir fühlen uns, liest man in der „Gartenlaube für Österreich“, Dezember 1866 – im Jahr der Schlacht bei Königgrätz, wo Österreich gegen Preußen noch mit Vorderladern gekämpft und endgültig verloren hat – „wir fühlen uns als Urheber unserer Handlungen“, verantwortlich für das, was wir tun wie für das, was wir lassen. Aber Gott weiß alle Handlungen voraus. Folglich könnte man schließen, schreibt Stifter, unsere Handlungen sind eine „Weltnotwendigkeit“ und wir nicht ihre Urheber. Und doch sind wir dafür verantwortlich, wir „wissen es wie unser Dasein selber, dass sie die unsrigen sind“. –
„Wo liegt nun der Zwiespalt? Er liegt in unserer Vorstellung von der Zeit, er liegt in der Vorstellung ‚Zukunft‘. Er liegt darin, dass wir nicht wissen, was die Zeit ist.“ „Im Vergnügen ist sie kurz, im Leiden in ungeduldiger Erwartung unendlich lang“. Wir wissen nicht, was die Zeit ist. Stifter hat seinen Kant studiert: Vielleicht ist sie gar nichts Wirkliches, vielleicht sind Zeit und Raum nur die Einrahmungen, das „Gesetz für unsere Vorstellungen, dem wir nicht zu entrinnen vermögen … Dann wäre Gott … in der Zeitlosigkeit oder eigentlich Ewigkeit. Dann ist keine Zukunft …“
Vielleicht! „Wozu die müßigen Fragen, … denen vielleicht gar niemals eine Lösung wird und sehr wahrscheinlich auch gar nicht nottut“, liest man weiter, „kehren wir zum bürgerlichen Silvesterabend zurück“, schreibt Stifter (dabei handelt sein Aufsatz zu zwei Dritteln gar nicht davon, sondern von der Zeit und unserem grundgelegten Unwissen über die Selbstverständlichkeiten des Lebens): Man feiert ihn im häuslichen Kreis, vergewissert sich der „ungeschmälerten Fortdauer der Achtung, der Verehrung, der Liebe“, schenkt und zeigt mit der Wahl der Geschenke seine Aufmerksamkeit und seine Liebe, vergisst auch auf den Briefträger, die Gemeinde, das Vaterland, die Welt nicht. Auch in den Geschäften und Gewerben wird gefeiert; die Dienste des Alltags kommen zu Ehren. Herzenswünsche werden ausgesprochen, aber auch lästige Pflicht und Schuldigkeit bewegen uns an Silvester, und Aberglauben; und Mancher versucht der Einsamkeit zu entrinnen. Und „dessen Lebenszweck das Vergnügen ist, der schreibt dem heiligen Silvester die Schuldigkeit zu, dass an diesem Tage ein noch größeres Vergnügen komme … und … junge Leute schießen mit … Gewehren das neue Jahr an oder treiben anderen … Unfug“.
Bevor ich Stifters bescheidenen Schluss des Toasts auf das neue Jahr zitiere – bescheiden im Hinblick auf die Größe unserer Unwissenheit –, möchte ich ihnen noch zwei kleine Fundstücke weitergeben. Das eine ist ein kleines Gedicht. Es erinnert daran, dass wir nicht nur mit Gott verwandt sind, wie es in einer Lesung dieser Tage geheißen hat, sondern auch mit den Tieren. Ihr Umgang mit der Zeit könnte uns armen Menschen helfen, die keine Zeit haben – Zeit, die es gar nicht gibt, vielleicht.
Katzensprung
Ein leises Tapsen
und dann
der
Sprung
Von Sekunde zu Sekunde
geschmälerter Blick. Lustvoll erzittert
der Schwanz
Tierisch vollkommen schnurrt
die Zeit
Warten wie
Firlefanz
auf den großen
Sprung
Die Katze, die eins ist mit dem Geheimnis der Zeit, heißt – wir haben es gehört – Firlefanz. Die sie gesehen hat, heißt Marlene Giesinger und lebt in Altach. Es wäre etwas Schönes, wenn bis zum nächsten Silvester einmal ein Abend zustande käme, wo die, die es brauchen, auf ihre Gedichte zu hören Gelegenheit hätten, die, die Freude daran haben (würde Stifter sagen).
Noch ein zweites Fundstück zum Thema: To toast ist englisch und bedeutet ‚rösten’, in der zweiten Bedeutung aber auch – in allen Sprachen – einen Trinkspruch anbringen, das Glas erheben auf jemanden oder etwas’. (Das geht soweit, dass jemand, der besonders beliebt war, der Toast von Berlin, Paris, Johannesburg, Rio … genannt wurde.) Wie hängen diese zwei Bedeutungen zusammen? Wir sind hier – ganz kirchlich – mehr oder weniger auf einer 50+-Veranstaltung (erheben wir das Glas auf die Jungen, die die Runde rund machen!): Vielleicht gibt es unter uns ältere Leute, die sich noch erinnern an den Zusammenhang. Nein? Vielleicht hat es einen solchen Zusammenhang zwischen Toastbrot und Segensspruch auch nur in Ländern gegeben, in denen Wasser etwas Rares und seine Würzung und Reinigung notwendig war.
Jedenfalls in England – es ist erst zwei-drei Generationen her – war das toast water verbreitet und bekannt, und nicht nur in England offenbar, auch die Comtesse de Ségur hat ein Rezept aufgeschrieben: Manière de faire de l’eau panée, wie man brötiges Wasser macht. Das toast water war das beste Wasser – als das Brot etwas Wertvolles war, trotz seiner Verbreitetheit. Ein paar Scheiben solchen frischen Brotes wurden auf der Herdplatte gedörrt – von torrere, torsui, tostus – nicht zu wenig geröstet, aber auch nicht angebrannt – wehe, dann war die Folge nicht Wohltat, sondern Bitterkeit! – und in kaltes Wasser gelegt. Solches toast water wurde im Sommer im Keller sorgsam in Krügen aufbewahrt, ein besonderer Saft, ein Labsal.
Wir wissen nicht, was die Zeit ist. Wir wissen auch von vielen einst heilsamen Praktiken nicht mehr. Heute ist „Brot und Wasser“ allenfalls eine Redewendung, ein Synonym fast für Gefängnis. Geblieben ist nur die schnell im tuckernden Toaster angebratene Weißbrotscheibe mit speziellem Knackdesign, noch warm zu bestreichen mit Butter und wenn vorhanden zu belegen mit allem Luxus des postkolonialen und postindustriellen Europa. Und dabei hat einmal, vor drei Generationen noch, geröstetes gutes Brot das Wasser gut gemacht (nicht zu viel geröstet, wohlgemerkt)! Ich aber bin hier und heute sozusagen derjenige, der den Krug mit dem guten Wasser bis zur Neige austrinkt und am Ende auf das getoastete Brot stößt und – eben – einen Toast anzubringen hat:
Auf das Selbstverständliche, dass es gut wird und gut tut! Auf Alt und Jung, denn eine Generation allein und unter sich, das ist nichts! Das letzte Wort soll bei Adalbert Stifter bleiben, dem sorgfältigen Autor, der 1866 – auch in nicht gerade einfachen Zeiten – seinen Aufsatz „Der Silvesterabend“ mit folgenden Wünschen für das neue Jahr abschloss: „Der Himmel möge fügen, dass das Gute, das manchen zuteil ist, daure, und dass der tiefe Schmerz, der in manches Herz gekommen ist, sich mildere.“ Ein gutes Kalenderjahr 2013!
(Willibald Feinig)
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:
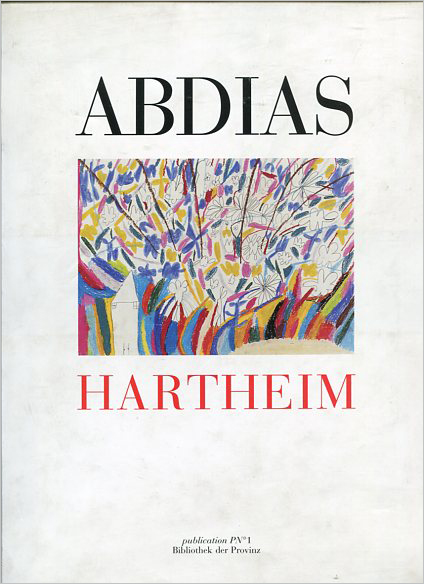
Abdias – Hartheim
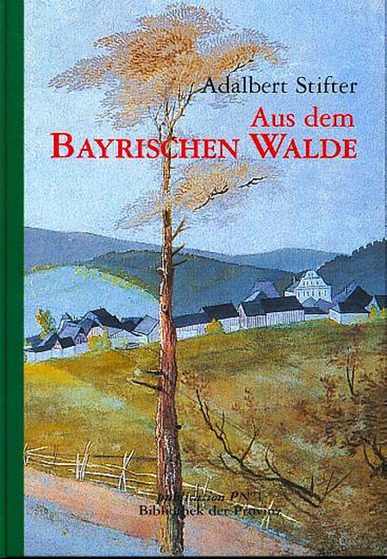
Aus dem bayrischen Walde
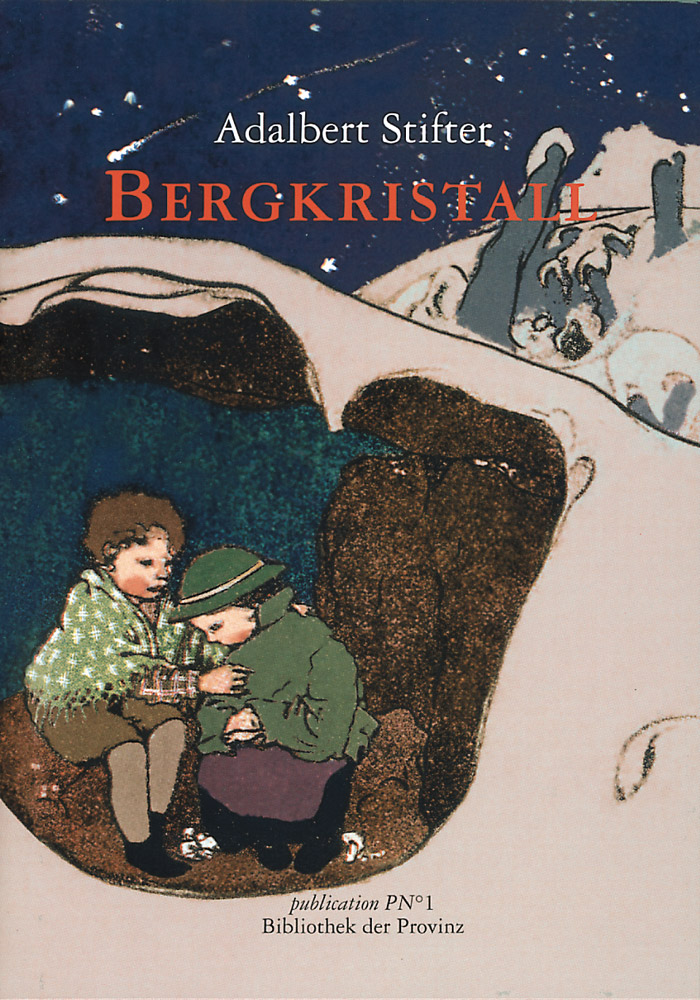
Bergkristall
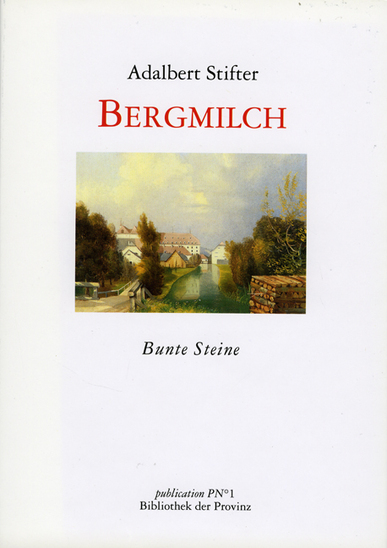
Bergmilch
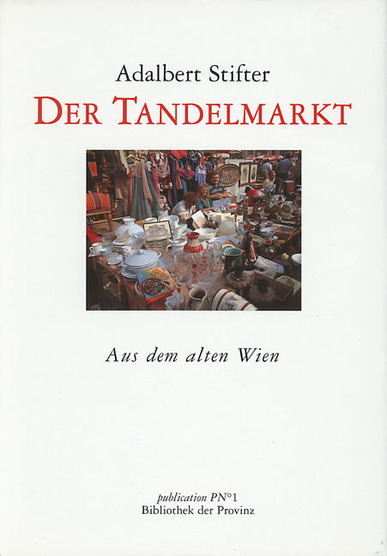
Der Tandelmarkt
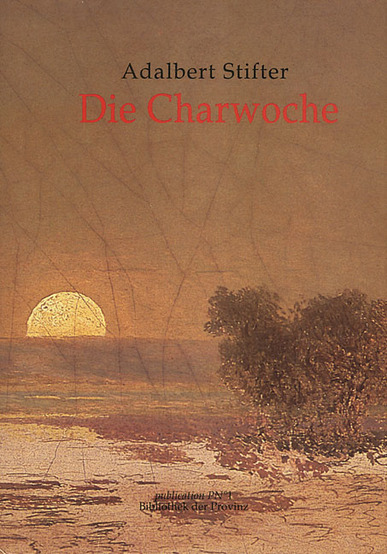
Die Charwoche
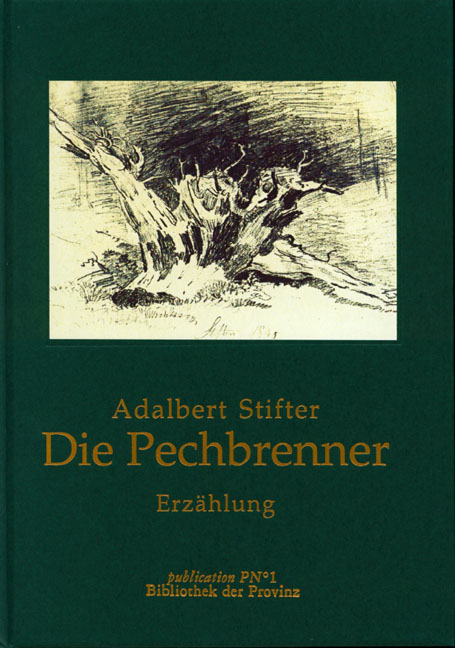
Die Pechbrenner
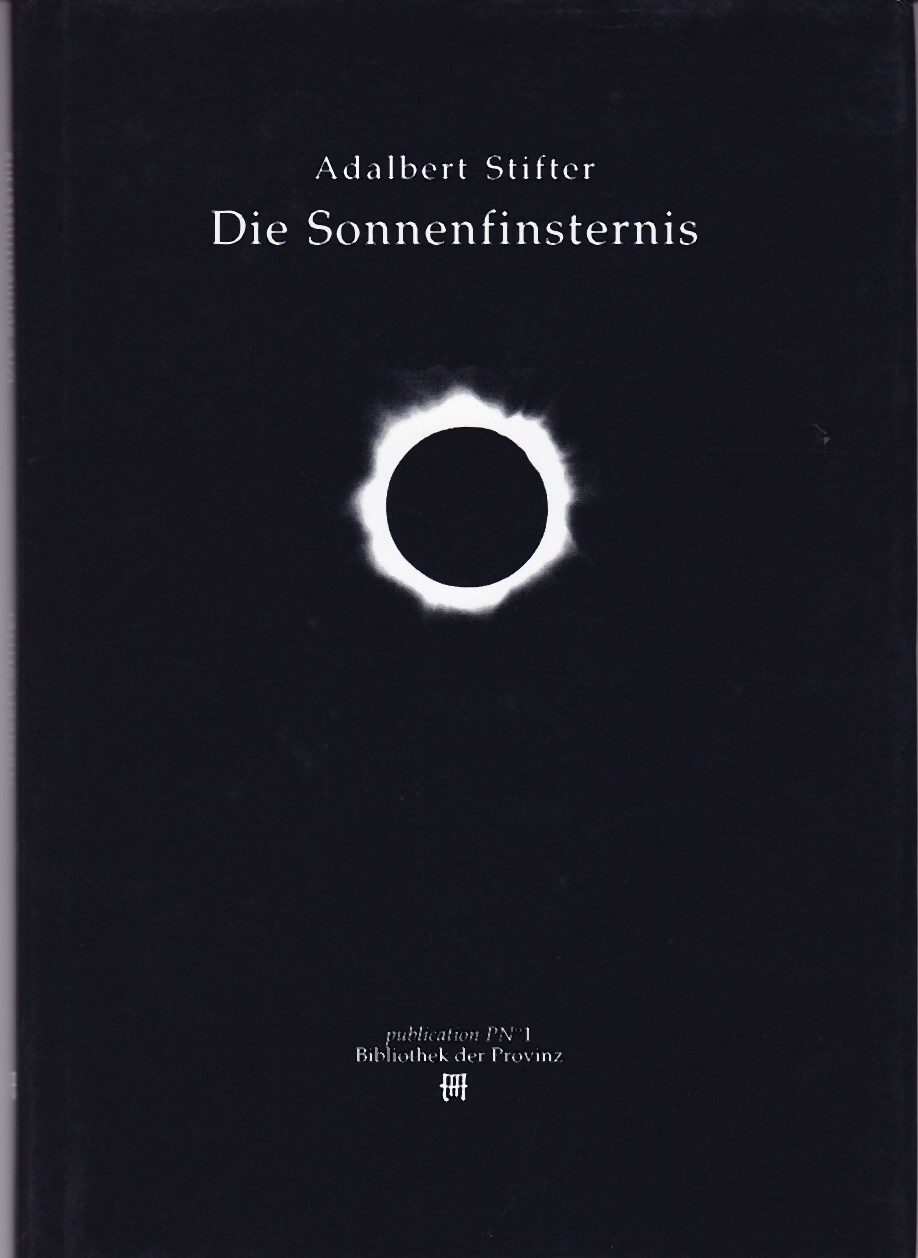
Die Sonnenfinsternis
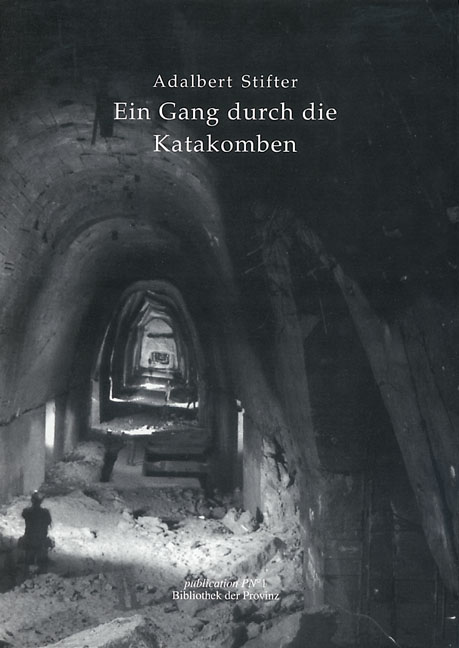
Ein Gang durch die Katakomben
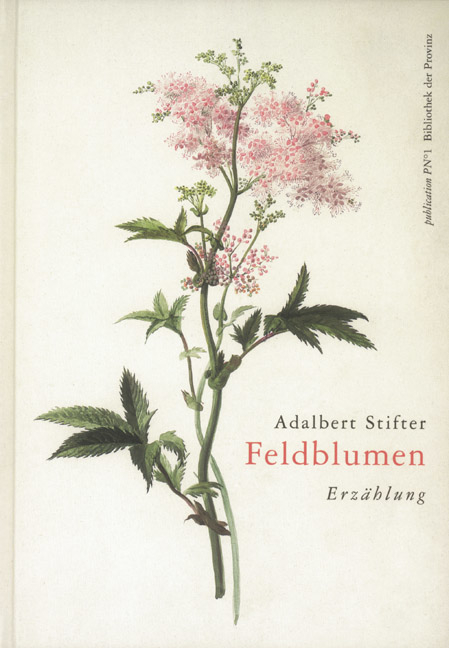
Feldblumen
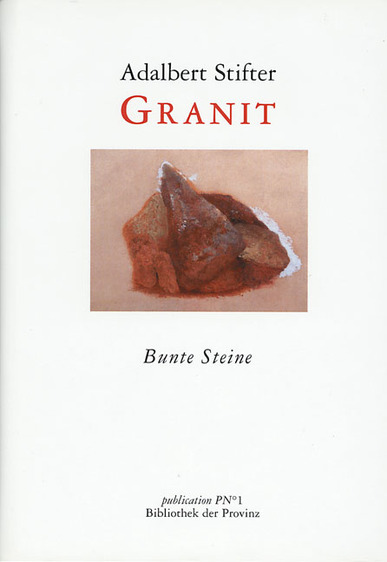
Granit
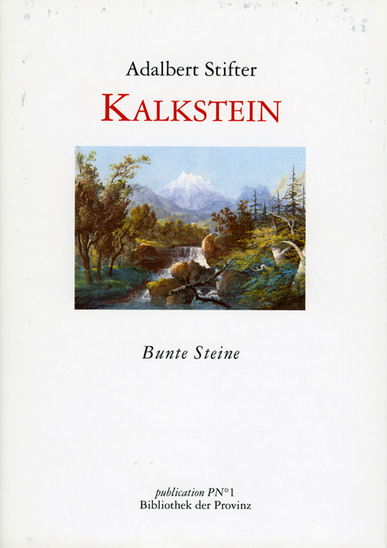
Kalkstein
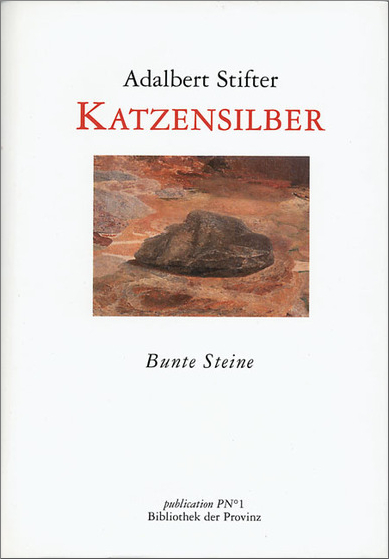
Katzensilber
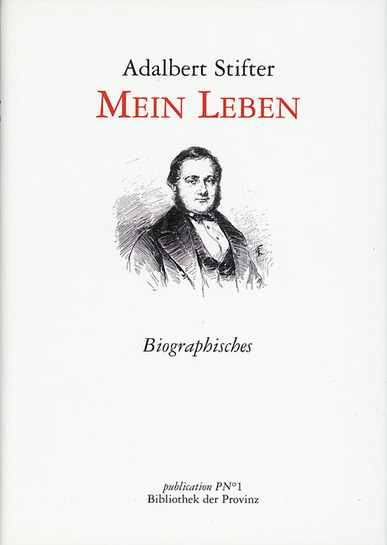
Mein Leben
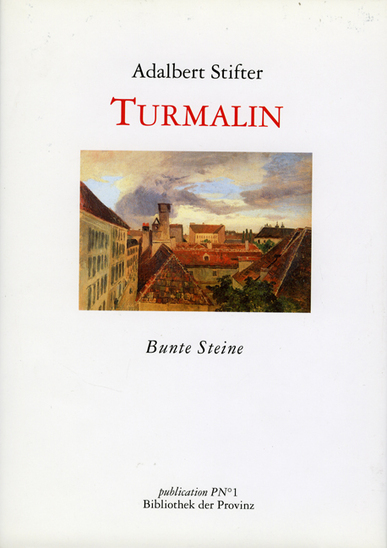
Turmalin
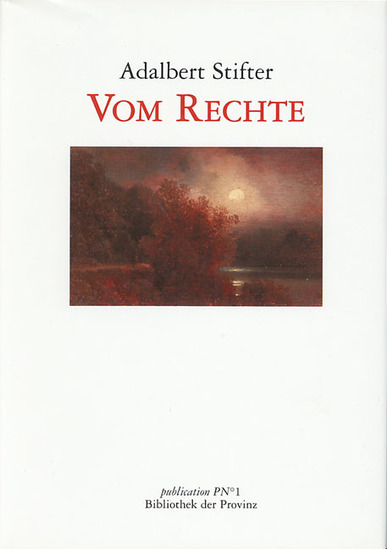
Vom Rechte
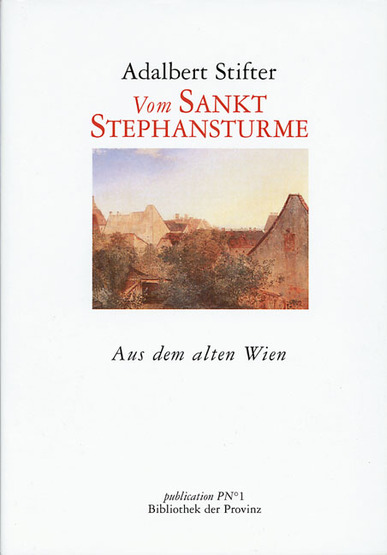
Vom Sankt-Stephansturme
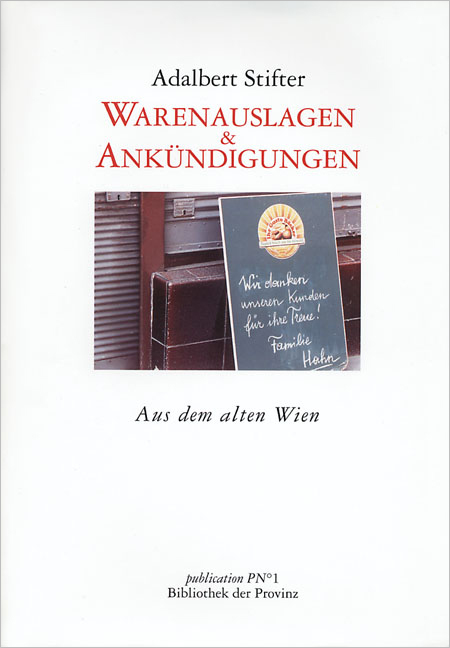
Warenauslagen & Ankündigungen
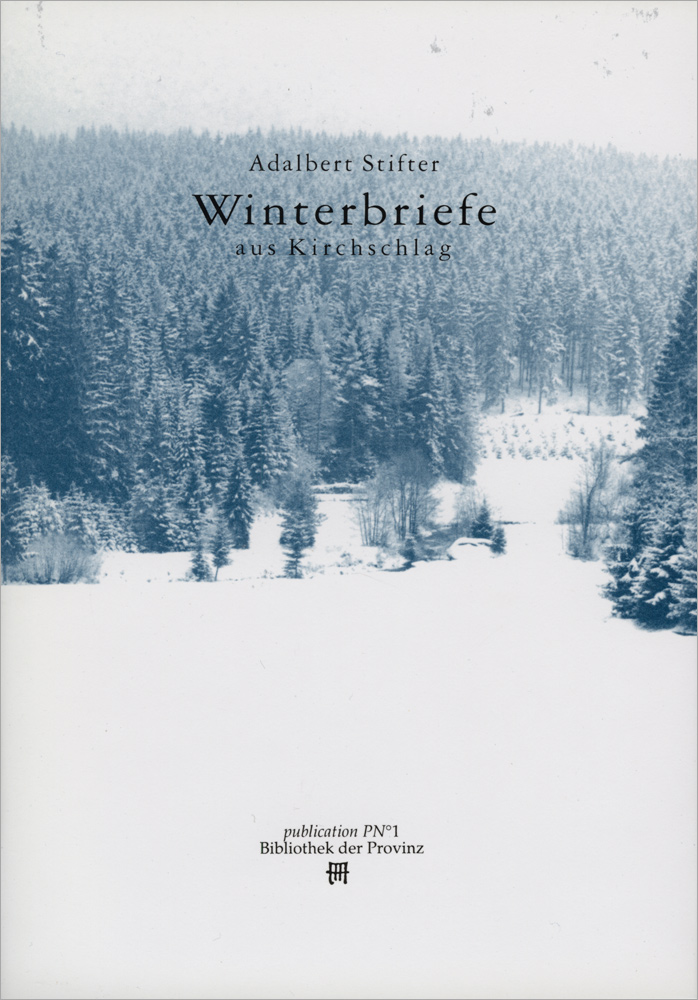
Winterbriefe aus Kirchschlag
