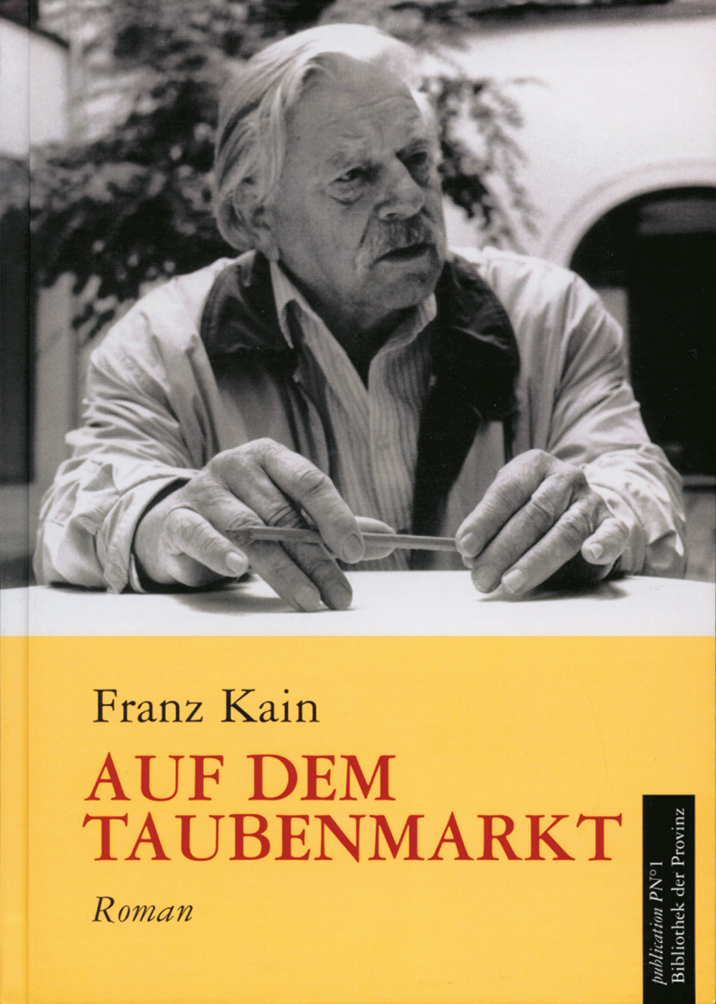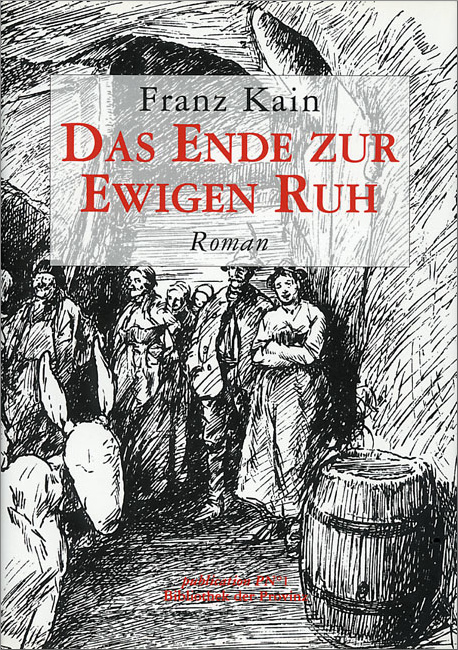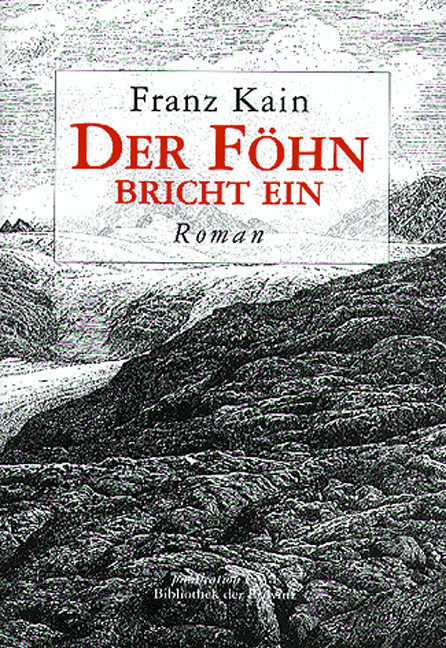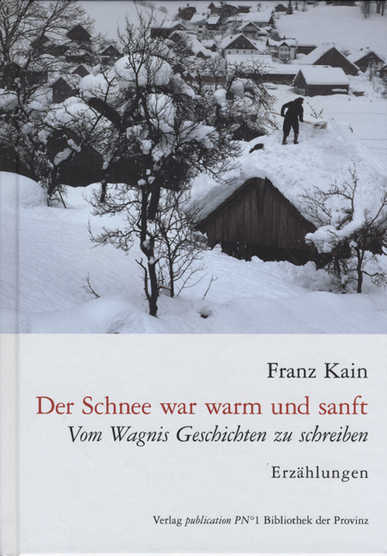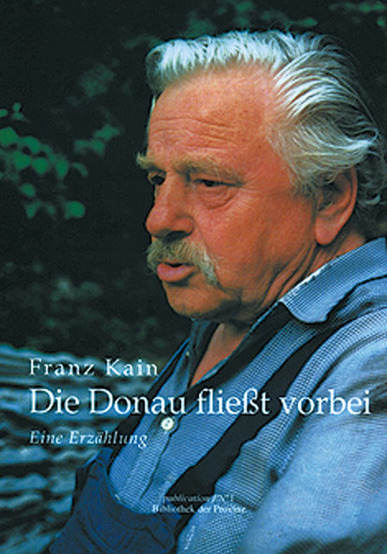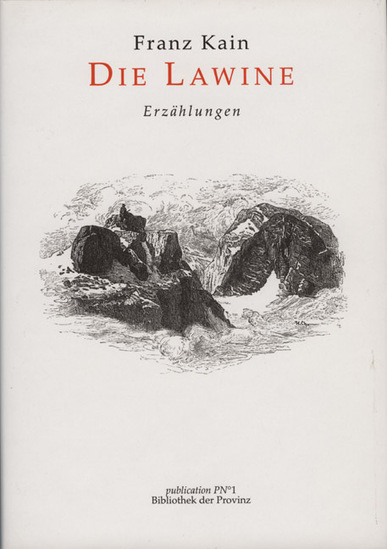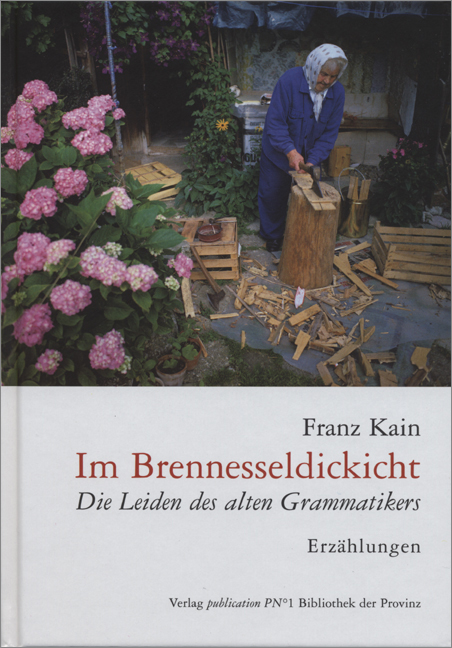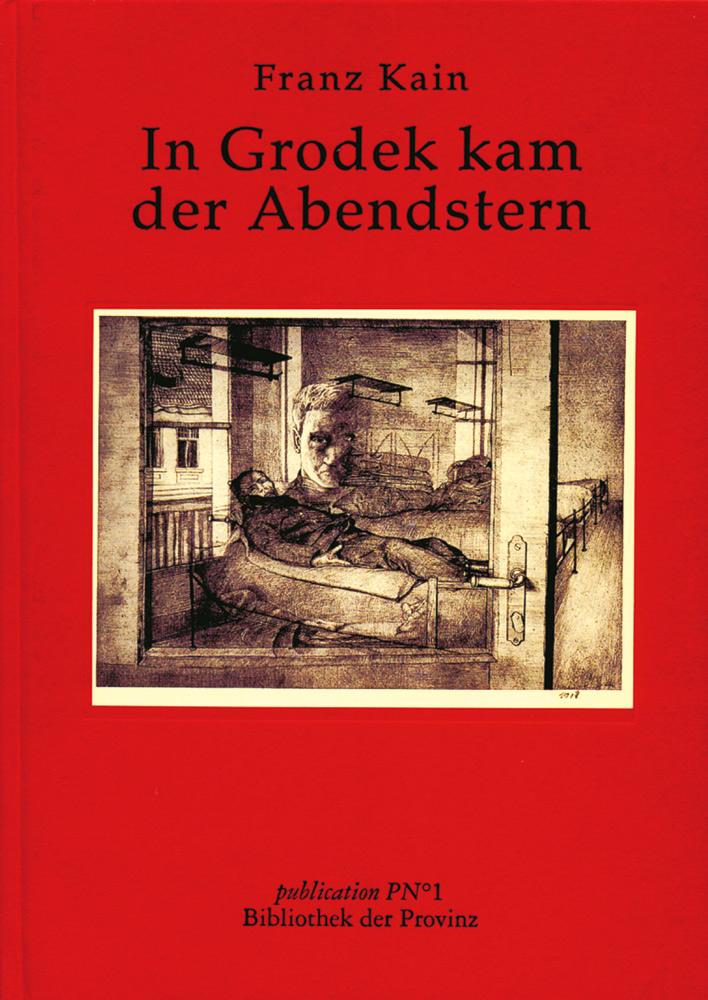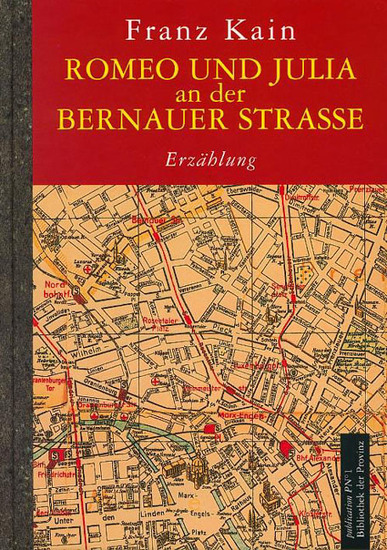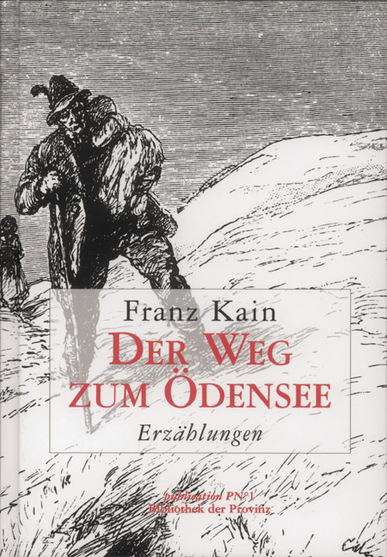
Der Weg zum Ödensee
Erzählungen
Franz Kain
ISBN: 978-3-85252-084-1
21 x 15 cm, 200 Seiten, Hardcover
19,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Heimatkunde
Der Eucalyptus globulus, der Fieberbaum, gedeiht in jener Gegend, in der die Geschichten dieses Buches spielen, nicht. Dennoch stellt Franz Kain, der an Wissen und Genauigkeit auch in diesen Dingen nicht leicht zu übertreffen sein wird, seinen Geschichten ein Prosa-Stück voran, das den Namen dieses Baumes im Titel nennt. Die wenigen Sätze des so einfachen, beim zweiten Hinsehen aber so rätselhaften und vielschichtigen Textes zeichnen ein Tableau, ein Bild der Landschaft im Spätsommersonnenschein, mit dem Ring der Berge, mit reifen Äpfeln, dem Murmeln eines Baches, der Schnapsbrennerhütte und einem rothaarigen Mädchen, das gedankenverloren die ersten Haselnüsse aufklopft. Doch der Schein der stillen Freundlichkeit ringsum trügt. Nachts zucken die Blitze »der Welt«, wie es heißt, über das Tal hin, so wie auch Blitze von hier »in die Welt hinaus« fahren.
Was nach Geborgenheit, Frieden, Glück und Idylle aussieht – landläufig mit dem Begriff Heimat umschrieben –, ist doppelbödig, hat noch eine andere Seite, eine Nachtseite. Was die Fremden für eine Laune der Natur halten, erkennt der Wissende als »Brandmal« und als Wunde; die Hähne, die hier noch krähen, dem Fremden wohl nicht immer zur Lust, krähen dreimal, Zeichen des Verrats und der Heimtücke. Die vom kalten Licht der Blitze gezeichneten Schatten sehen aus wie Gerippe; mitten im Spätsommersonnenschein kommt ein Frösteln die Hänge herab, das einen erschauern läßt; es ist der Schneeluft, der vom Toten Gebirge herüberweht. Ist es nicht auch der Eishauch des Todes?
Der Erzähler hört, sieht, empfindet anders als der von außen kommende Betrachter, der Fremde, der die Gegend um das Tote Gebirge bloß als schönes Landschafts wahrnimmt, der nur schaut, aber nichts sieht. Dieser Erzähler sieht, weil er weiß. In seinem Essay Am Hallstätter See läßt Franz Kain die Figur, hinter der erkennbar der Autor steht, sagen: »Er hört in vielen Sprachen die Schönheit dieser Gegend rühmen. Nur einem kann er nicht beipflichten (…), wenn Bewunderung geschmeichelt wird, wie lieblich und idyllisch doch die Landschaft um den Hallstätter See sei. Da wird er immer recht nachdenklich und kann die Fröhlichkeit nicht teilen. Nein, lieblich ist sie nicht. Er weiß zu viel von ihr.« Bezeichnenderweise hat Franz Kain hat auf die Frage, was seine beste Eigenschaft sei, so, geantwortet: »Mein sehr gutes Gedächtnis« und auf die Frage nach seiner schlechtesten noch einmal: »Mein sehr gutes Gedächtnis«. Ein gutes Gedächtnis kann nur dort als schlechte Eigenschaft gelten, wo das Vergessen Gewohnheit, wo Erinnerung eine Last ist. Diese Last, die wie ein Gebirge, ein totes Gebirge, auf dem schönen Land liegt, ist die Last der Geschichte mit ihren Bergen von Toten. So ist der Weg zum Ödensee, auf den Franz Kain uns hier, wie in allen seinen Büchern, mitnimmt, im wörtlichen Sinne ein »Weg ins Tote Gebirge der Geschichte«. Diese bildkräftige Wendung hat er in seinem grundgescheiten Nachwort Von den Würgmalen selbst geprägt, und treffender ist sein Schreiben nicht zu charakterisieren.
Es geht in seinen Geschichten immer auch um die Fähigkeit der Wahrnehmung, die genaue Beobachtung, Erinnerung und Wissen verbindet. In seinem Text über die Würgmae, der von eben diesen Eigenschaften und Fähigkeiten handelt, der gleichzeitig aber auch Franz Kains poetologisches Verfahren beschreibt, hat er diese Fähigkeit den »Holzverstand« genannt. Es ist dies ein Verstand, der die Dinge der Welt und das Tun und Lassen der Menschen mit der gleichen liebevollen Genauigkeit, mit dem gleichen wachen Sinn für Zusammenhänge betrachtet wie der alte Bergbauer ein Stück Holz anschaut, aus dessen Faserung er Standort und Geschichte des Baumes zu lesen versteht, aus dem das Brett geschnitten wurde. Einem solchen Verstand wäre es, um die Sache auf den Punkt zu bringen, um den es geht, eben nicht möglich, von der Schönheit und Qualität des Granit zu reden, den man in diesem Lande finden kann (und der nicht zufällig im Titel einer Stifterschen Erzählung begegnet), ohne gleichzeitig daran zu denken, daran zu erinnern, daß gerade die Schönheit dieses Steines ausschlaggebend war, auf jenem »schönen Flecken Mauthhausen« (Friedrich Nicolai, 1783) an der Donau ein Konzentrationslager zu errichten. Daß nicht nur die der Gauhauptstadt Linz, der Heimatstadt des Führers, zugedachten Monumentalbauten aus Mauthausener Granit, sondern auch das dort geplante Denkmal zur Gründung des Großdeutschen Reiches aus diesem schönen Stein erbaut werden sollten, sagt alles: Die Fundamente dieses Reiches, das Material für das Denkmal seiner Gründung, stammten aus einem Todeslager, sie stammten aus der Hölle…
(Klaus Amann im Vorwort)