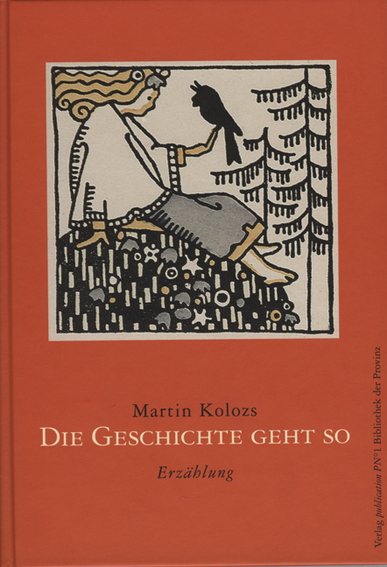
Die Geschichte geht so
Erzählung
Martin Kolozs
ISBN: 978-3-85252-748-2
21 x 15 cm, 62 S., Hardcover
13,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[Mit einem Vorw. von Felix Mitterer]
Geschichten werden auf der ganzen Welt und jeden Tag erzählt. Zwischen allen möglichen Menschen. Von der Großmutter dem Enkel, vom Freund dem Freund, einem Unbekannten in der Straßenbahn und der zufälligen Bekanntschaft auf Reisen. Lügengeschichten, Heldengeschichten, Kriegsgeschichten, Liebesgeschichten. Eine große Zahl, die mit jeder gemachten Erfahrung zunimmt und stetig wächst. Und immer, wie selten sonst, ist jemand aufmerksam und erlebt die Abenteuer, wie die seinen, nochmals und von allem Anfang an mit. Dann reiten plötzlich zwei, in der Meinung es seien Riesen, auf Windmühlen zu und sehen beide in einer Herde Schafe, ein großes feindliches Heer. Oder machen sich gemeinsam auf den Weg einem Zauberer das Handwerk zu legen, einen Drachen zu töten, einen Goldschatz zu heben, ein Fräulein zu befreien. Aber was geschieht, wenn niemand zuhört, weil die Geschichte, die man zu erzählen hat, keinem gefällt? – Dann kann man durchaus seltsam werden und beginnen mit sich selbst zu reden. So wie es auch … einmal angefangen hat.
Rezensionen
Helmuth Schönauer: Martin Kolozs, Die Geschichte geht soErzählen heißt normalerweise, dass etwas in einem Zeitablauf von früher in einen Zeitablauf der Gegenwart gebracht wird. Wie bei einer Sanduhr gibt es ein Stoffdepot, das über die Engstelle in die Gegenwart rinnt.
Martin Kolozs Erzählung Die Geschichte geht so ist eine Erzählung über das Erzählen. Dabei wird so gut wie alles verrückt, die Spielregeln werden ununterbrochen verändert, Vergangenheit kann Zukunft sein, die Gegenwart ein Stoffuniversum an Gleichzeitigkeit.
In vierzig kleinen, kompakten Szenen wird letztlich klar, dass man die Zeit aushebeln kann, wenn man dafür das Brecheisen einer guten Literatur zur Verfügung hat.
Rein äußerlich passiert scheinbar etwas ganz Normales, ein Psychiater macht sich auf, um einen etwas schrulligen Alten zu testen und vielleicht ein Gutachten zu verfassen, worin dessen Geisteszustand gewürdigt wird.
Aber für so ein Unterfangen müsste man wissen, was normal ist und was verrückt, was simples physikalisches Gesetz ist und was Zauberei. Dem Psychiater spielt bald einmal seine eigene Wahrnehmung wilde Streiche. Er glaubt sich, noch während er die Dinge sieht, nichts, wie soll er da für andere etwas klar machen. Der Alte nämlich ist gar nicht so verrückt, er verwendet einfach ungewöhnliche Gerätschaften für sein Tun. Und er nimmt es mit der Zeit nicht so genau.
Viele Stationen der Erzählung sind daher seitenverkehrt angelegt wie ein Kartenblatt, das man verkehrt herum hält. Manchmal geht die Entwicklung statt in Richtung Pension stracks zurück in die eigene Kindheit, und es macht eigentlich keinen Unterschied.
Gegen Schluss haben offensichtlich die beiden Protagonisten ihre Rollen getauscht, denn der Psychiater ruft bei sich zu Hause an und ist verwundert, dass er zu Hause selbst abnimmt und seine eigene Stimme als Gegenüber hört.
Letztlich ist auch der Unterschied zwischen Echtzeit und erzählter Zeit aufgehoben, die Geschichte macht sich ihre eigene Realität und endet in einer Endlosschleife. Denn kaum ist scheinbar alles erzählt, kommt die magische Fügung, mit der wieder alles von vorne beginnt, nämlich die Geschichte geht so…
Martin Kolozs hat eine verrückt realistische Geschichte aufgeschrieben, als Leser steht man auf manchen Seiten neben sich und schaut sich beim Lesen zu, die innere Logik hat Zaubersprünge und Realitätsabschürfungen, die es locker mit Alice im Wunderland aufnehmen. Und manchmal wird der Sound ganz schlicht und einfältig, in diesen Sätzen sind dann die höchsten Wahrheiten eingeschlossen. „Man soll einer guten Geschichte nie vorausgreifen, das nimmt ihr die Spannung“ (58) sagt einmal der Alte, und meint vielleicht die ganze Literaturgeschichte.
(Helmuth Schönauer, Rezension vom 11. September 2007)
https://www.lesen.tibs.at/node/1097
Martina Wunderer: Martin Kolozs: Die Geschichte geht so.
„Niemand stirbt so arm, dass er nicht irgend etwas hinterlässt“, schreibt Pascal. „Gewiss auch an Erinnerungen“, ergänzt Walter Benjamin.
Geschichten werden auf der ganzen Welt und jeden Tag erzählt. Zwischen allen möglichen Menschen. Von der Großmutter dem Enkel, vom Freund dem Freund, einem Unbekannten in der Straßenbahn und der zufälligen Bekanntschaft auf Reisen. Lügengeschichten, Heldengeschichten, Kriegsgeschichten, Liebesgeschichten.
Doch „dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein“, meinte Rilkes Malte Laurids Brigge schon vor hundert Jahren. Wie es zu diesem Ende der Erzählungen kam, erklärt Walter Benjamin in seiner Studie über Nikolai Lesskow: „Der Erzähler – so vertraut uns der Name klingt – […] ist uns etwas bereits Entferntes und weiter noch sich Entfernendes“, denn „Geschichten erzählen, ist ja immer die Kunst, sie weiter zu erzählen, und die verliert sich, wenn die Geschichten nicht mehr behalten werden.“
Oder wenn niemand mehr zuhören mag – dann kann man durchaus seltsam werden und anfangen, mit sich selbst zu reden. So wie es auch dieser Mann einmal begonnen hat. Der Namenlose erzählt eine Geschichte im Selbstgespräch, er ist Don Quijote im Kampf gegen die Windmühlen, das erzählende Ich und seine Wirklichkeit sind Produkte schöpferischer Einbildung, doch nicht der eigenen, sondern der Märchenerzähler vergangener Zeiten. Die daraus resultierende Unsicherheit über die eigene Identität und den eigenen Stoff schlägt sich auch in der Textstruktur von Kolozs‘ Erzählung nieder, die unter Verzicht auf Linearität in einundvierzig Kapiteln ein Spiegelkabinett aus intertextuellen Bezügen, poetologischen Reflexionen und selbstreferentiellen Textverweisen entwirft.
Also es war einmal dieser Mann. Ein einsamer, schrulliger alter Mann in einer feuchten, kleinen, mit Nippes vollgestellten Stadtwohnung. Der Ich-Erzähler, ein Psychiater, soll nach ihm sehen. Er stellt Fragen nach seinem Befinden, nach seiner verstorbenen Frau, ob er an Gott glaube und ob er allein zurechtkomme. Aber er sei nicht allein, entgegnet der Alte, Zwerge, Ritter, Seeungeheuer leisten ihm Gesellschaft, und Henriette, seine Frau, sei ja nach ihrem Tod auch nur ins obere Stockwerk gezogen, denn wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, das weiß doch jedes Kind.
Ausgefallene Vergleiche, kühne Metaphern und Assoziationen, Wortspiele und Stilwechsel kennzeichnen die Erzählerreden, sie verfremden das Alltägliche und verleihen ihm eine herausfordernde poetische Wirklichkeit. Durch die intertextuelle Verstrickung der Figuren, die Verschränkung der Erzählebenen und durch das fließende Ineinander von Erinnerung und Wachtraum, von Erfahrung und Erdichtung entfaltet sich so vor dem Auge des Lesers ein Zwischenreich von Realität und Phantasie, das Reich der Fiktion.
Dort begegnet der Ich-Erzähler – als ein anderer – dem Zauberer und wird sein Lehrling. Während er ihm dabei hilft, einen Gedanken zu verfolgen, macht er Bekanntschaft mit der weißen Frau aus dem Wald, mit dem Gedankenverwalter und dem bösen Gedanken, der der Aufmerksamkeit des Torwärters – ein moderner Charon – entschlüpft ist und nun alle Erinnerungen des Zauberers und damit auch ihn selbst zu verschlingen droht. Er zieht sie ins Vergessen. Weil dorthin kann ihm keiner von uns folgen, ohne selbst vergessen zu werden.
„Nun ist es aber an dem“, so Walter Benjamin, „dass nicht etwa nur das Wissen oder die Weisheit des Menschen, sondern vor allem sein gelebtes Leben – und das ist der Stoff, aus dem die Geschichten werden – tradierbare Form am ersten am Sterbenden annimmt.“ Gerade am Ende des Lebens eines Einzelnen drängen seine Lebenserinnerungen zur Mitteilung, um sie der Nachwelt zu bewahren. Vergiss mich nicht und die Geschichte wird weitergehen, fleht der Zauberer, nun eins mit dem Alten, seinen Lehrling, Arzt und Erzähler an. Denn als Erinnerungswerk ist Erzählen eine Form des Widerstands gegen die Zeit und gegen den Tod – man denke nur an Scheherazade, die durch ihr Erzählen in 1001 Nacht das Todesurteil aufzuschieben vermag. Erzählen ist aber auch eine Form der Ich-Suche und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Und so ist es Kolosz’ Erzähler am Ende doch noch möglich, sich selbst erzählend Ich zu sagen: „Nun“, sagte ich, „die Geschichte geht so…“
(Martina Wunderer, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, August 2011)
http://www.literaturhaus.at/index.php?id=9090
Brigitte Radl: zaubertraumlanderinnerungsgeschichte
Wenn einer glaubt, das, was er selbst erlebt hat, vergessen zu können, liegt er falsch. Denn er ist Teil seiner Geschichte. Das wäre fast so, als würde er ein Buch in der Mitte zu lesen beginnen und glauben, er könne den Schluss trotzdem verstehen. Er müsste sich schon selbst vergessen, um nicht mehr Teil seiner Geschichte zu sein. Wichtig ist einzig und allein, dass sie fertig wird. Welchen Sinn hätte es für sie sonst gehabt, erzählt zu werden?
Martin Kolozs’ „Die Geschichte geht so“ erzählt von einem alten Mann, der in einer kleinen, feuchten Innenstadtwohnung lebt und seit dem Tod seiner Frau Henriette sehr einsam ist. Der Psychiater kommt zu ihm um ein Gutachten zu erstellen, gerufen von einer vertrauten und doch merkwürdig fremden Stimme. Er hält den Alten für gleich irr wie die anderen Verrückten, mit denen er es täglich zu tun hat. Anscheinend lebt er in einer Fantasiewelt, die in keiner Karte verzeichnet ist, wo keine Straßen hinführen und deren Grenzen noch nicht gezogen wurden. Dort kann er sich in alles verwandeln, woran er denkt, ist einen Tag groß wie ein Riese, während er am nächsten aufrecht durch ein Schlüsselloch passt. Dass Fabelwesen und Märchengestalten tatsächlich existieren ist für ihn keine Frage. Den Umstand aber, dass sie unserer Welt nicht angehören, bestreitet er. Nach einer Weile jedoch beginnt der junge Arzt zu begreifen …
Der alte Zauberer lebt am Ufer eines silber-pechschwarzen Sees, noch hinter Sonne und Mond, brüllt mit dem Löwenzahn um die Wette, wenn er sich ärgert und trinkt kaltheißen Tau zum Frühstück. Manchmal fängt er sich abends einen hellen Stern als Leselicht vom Nachthimmel und bittet ihn, für ein Kapitel seines Buches zu bleiben. Er kann das Gras wachsen hören und den ganzen Tag so tun, als wäre er ein anderer. Eines Tages kommt ein junger Mann an den See, gerufen von einer vertrauten und doch merkwürdig fremden Stimme, und der Zauberer nimmt ihn als seinen Schüler auf, um ihm alles beizubringen, was er weiß. Als aber ein böser Gedanke seine Erinnerung stiehlt, beginnen seine ganze Welt und er selbst allmählich zu verblassen. Denn wer nur an die Vergangenheit denkt und Angst hat, mit ihr alles zu verlieren, macht sich keine Gedanken über die Zukunft mehr. Dabei gehören sie doch untrennbar zueinander, wie der Zauberer und die henriettenschöne weiße Frau aus dem Wald.
Martin Kolozs schnitzt in seiner Erzählung geduldig an sich nie wirklich schneidenden, aber dennoch voneinander abhängigen Parallelwelten, die Vergangenheit und Zukunft ineinander aufgehen lassen. Hinweise so klein wie Ameisenfußabdrücke und zunächst unbedeutend anmutende Motive, die sich mit einem wissenden Lächeln auf den Lippen dezent im Hintergrund halten, ermöglichen die Trennung von Erinnerung, Traum und Realität, auch wenn deren Kanten rund geschliffen sind wie glatte Steine im Flussbett. Ohne Scheu vor Perspektivenwechseln oder der Kürze seiner Erzählung führt der Autor den Leser auf eine verschlungene Spur, die gepflastert mit magischen Episoden und von Märchenfunken umgeben den Glauben an die eigenen Träume aus dem Dornröschenschlaf weckt. Man möchte selbst in der Zauberwelt mit den Nixen und Fischen im Mondenschein um die Wette schwimmen, in einen Esel verwandelt den Horizont unter den Hufen festhalten und gemeinsam mit dem Wind am Zaun Xylophon spielen. Und wenn man vorher tief Luft holt, um vollends in die geheimnisvolle Zauberwelt der Erzählung einzutauchen, erschließt sie sich von selbst und wird wahr. Denn wahr muss sie sein, sonst könnte man sie ja nicht erzählen.
(Brigitte Radl, Rezension in: Schreibkraft. Das Feuilletonmagazin #17, 2013)
http://schreibkraft.adm.at/ausgaben/17-alles-bestens/zaubertraumlanderinnerungsgeschichte
Anton Unterkircher: Martin Kolozs, Die Geschichte geht so
Wie eine Geschichte geht, das ist wohl am wenigsten bedeutsam. Wichtig ist, dass Geschichten erzählt werden und natürlich ist es genauso wichtig, dass die Geschichten gehört, gelesen und miterlebt werden. Das ganze Büchlein ist ein Plädoyer für Geschichten, für eine Aufhebung der (vermeintlichen) Gegensätze von Realität und Traumwelt. Und wenn Menschen etwas nicht wissen, dann spinnen sie Geschichten und träumen am hellichten Tag besser als in der Nacht im Bett. Und Geschichten, die erzählt werden können, sind wahr, sonst könnte man sie ja nicht erzählen …
Am Anfang dieser Geschichte sieht es so aus, als würden eigentlich zwei Geschichten erzählt. Zum einen die Geschichte eines Zauberers, der hinter Sonne und Mond an einem silbernen See lebt. Zum andern jene eines Psychiaters, der Verrückten hilft, ihren Verstand wieder zu finden. Dieser soll nun ein psychiatrisches Gutachten erstellen über einen alten Mann in einer kleinen und feuchten Altbauwohnung. Der Alte hat sich nach dem Tod seiner Frau in eine Traumwelt zurückgezogen, er ist davon überzeugt, dass es alle Phantasiewesen aus den Märchen- und Sagenbüchern gibt. Schon bald fließen die zwei Geschichten ineinander. Der Alte wird im Verlauf der Erzählung eins mit dem Zauberer und der Psychiater war einst selbst sein Zauberlehrling, der Xylophon auf einen Zaun spielte, der gelernt hatte, die Zeit rückwärts laufen zu lassen, und der, von seinem Zauberer in einen Esel verwandelt, einen Wettlauf bis zum Horizont gewinnt und diesen sogar mitnehmen kann. Der Zauberer erklärt ihm, dass er das als Mensch nie hätte machen können, da die Vernunft ihn gehindert hätte, daran zu glauben. „Aber um das Unmögliche wahr zu machen, muss man träumen können.“ Als Zauberer und auch als träumender Mensch kann man aber auch in die Erinnerung zurückgehen, um einen Gedanken zu verfolgen, zumal dann, wenn es sich um einen dunklen Gedanken handelt, dem es gelungen ist, die Mauer des Vergessens unbemerkt vom dort sitzenden kafkaesken Torwärter zu passieren und die Erinnerung zu stehlen. Ohne Erinnerung gibt es aber kein Zurechtfinden in der Gegenwart und keine Zukunft, denn hat man alles vergessen, gibt es keine Grundlage, von der aus man weiterdenken kann. „Vergiß mich nicht und die Geschichte wird weitergehen“ sagt der Zauberer zu seinem Zauberlehrling.
Felix Mitterer schickt das Büchlein mit einem begeisterten Vorwort auf Leseabenteuer, nicht zuletzt auch mit dem Hinweis, dass ein ähnliches Lesevergnügen wie bei Saint-Exupèrys „Der kleine Prinz“ zu erwarten sei: „Martin Kolozs hat eine Traumgeschichte über die menschliche Existenz geschrieben. Lakonisch, essentiell, hoch poetisch, komplex und einfach zugleich, genial in der Konstruktion und in der Verschränkung der Ebenen.“
(Anton Unterkircher, Rezension für das Forschungsinstitut Brenner-Archiv, 2007)
http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/literatur/tirol/rez_07/unterk_diege.html
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:
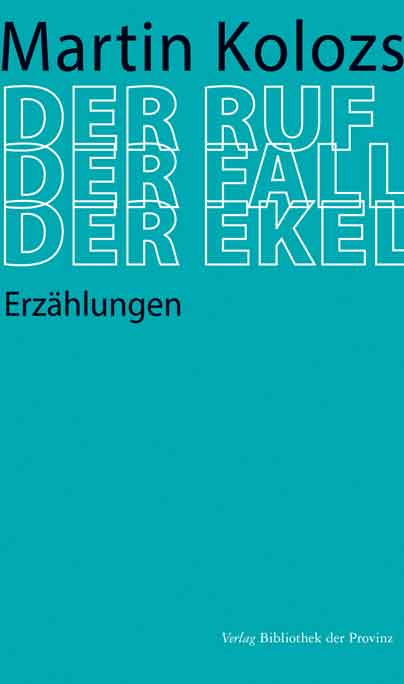
Der Ruf – Der Fall – Der Ekel
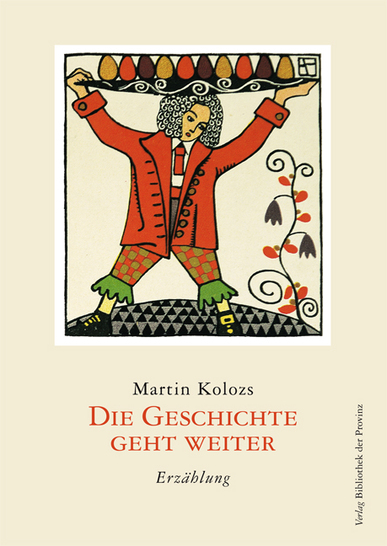
Die Geschichte geht weiter
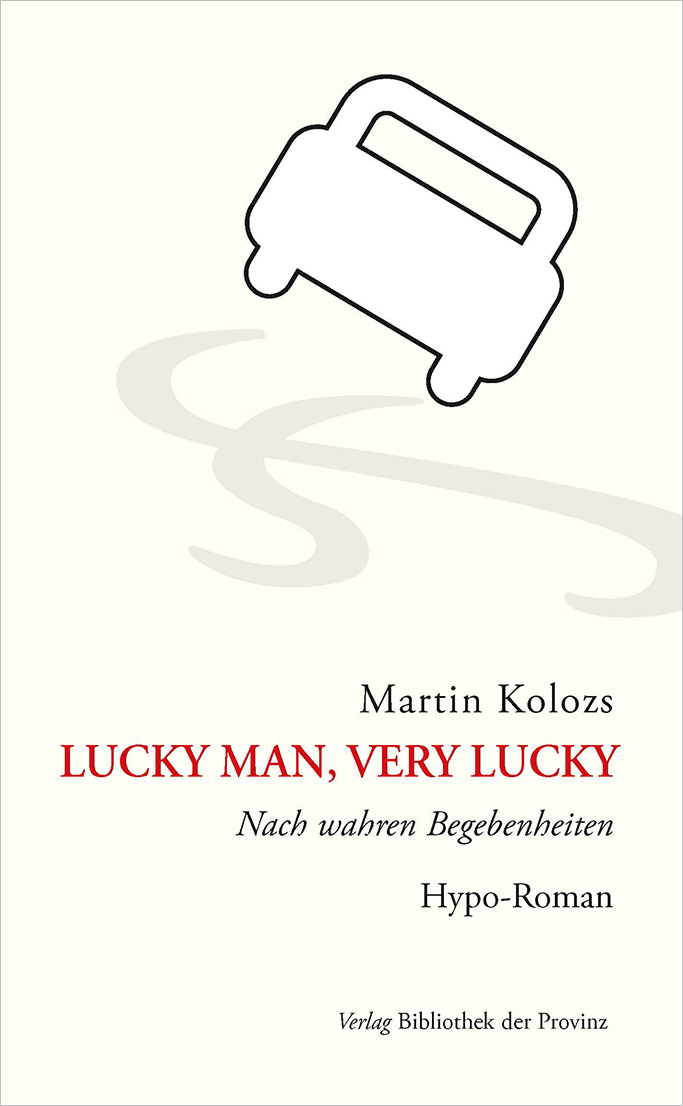
Lucky man, very lucky
