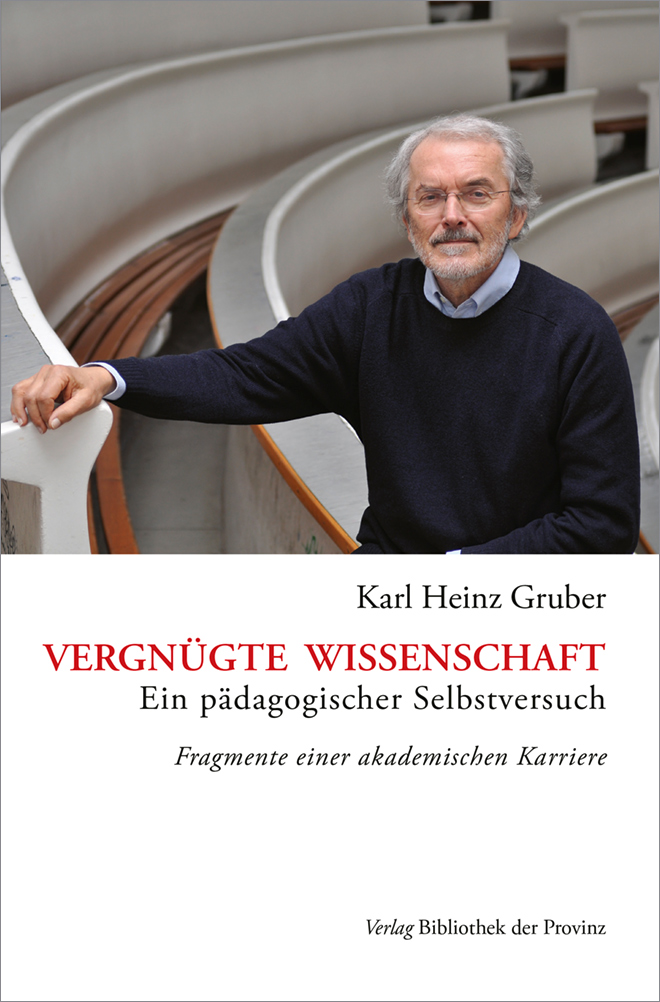
Vergnügte Wissenschaft
Ein pädagogischer Selbstversuch · Fragmente einer akademischen Karriere
Karl Heinz Gruber
ISBN: 978-3-99126-131-5
19,5 x 13 cm, 144 Seiten, Hardcover
€ 18,00 €
Neuerscheinung
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Der pädagogische Selbstversuch Karl Heinz Grubers kann seine Nähe zu Monty Python’s Song „Always look at the bright side of [academic] life“ nicht verleugnen. Im Gegensatz zum nüchternen, manchmal bitteren soziologischen Selbstversuch des Soziologenpapstes Pierre Bourdieu, wird die Leserschaft mit den vergnüglichen Aspekten des universitären Alltags des Alt-Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Wien unterhalten.
Die zum Teil bereits im STANDARD-Album publizierten Texte zeigen den sozialen Aufstieg eines „working class kid“: von einer Substandard-Wohnung im Salzkammergut zum privilegierten Fellow am St. John’s College an der Universität Oxford, vom Lehrer der zweiklassigen Volksschule im oberösterreichischen Sauwald zum Vorsitzenden des CERI (Centre for Educational Research and Innovation), des OECD-Bildungsgremiums in Paris, von der wissenschaftlichen Hilfskraft in Wien zum Fulbright Gastprofessor an der Harvard University Graduate School of Education in Cambridge, Massachusetts.
Um nicht akademischer „Schreibtischtäter“ zu werden, hatte der Bildungsforscher viele Jahre schulischer Feldforschung „vor Ort“ – Japan, Schweden, USA und vor allem England – verbracht. Die Universität Oxford wurde ihm zur zweiten akademischen Heimat. Zahlreiche Anglizismen im Buchtext sind dieser Zeit geschuldet und verraten gleichzeitig seinen ursprünglichen Wunsch, Anglistik zu studieren. 1964, auf dem Weg zur Inskription, hatte ihn jedoch eine Tasse Tee der Sekretärin des Pädagogischen Instituts vom anglistischen Pfad der Tugend ins Labyrinth der Erziehungswissenschaft gelockt.
Rezensionen
Florian Gasser: „Unser soziales System ist unfair“Seit 50 Jahren erforscht Karl Heinz Gruber das österreichische Schulsystem und zieht nun eine bittere Bilanz
DIE ZEIT: Herr Gruber, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch Vergnügte Wissenschaft, Sie seien schon als Kind in den 1950er-Jahren verliebt gewesen in die Institution Schule. Ein kleiner Junge, der die Schule liebt – wie konnte das passieren?
Karl Heinz Gruber: Mein Vater war Arbeiter in einer Papierfabrik. Schule bedeutete für mich die Befreiung von den Zwängen meiner Klassenherkunft. Bücher waren ein Luxus; ich hatte nie genug zu lesen, sodass selbst Schulbücher zu einer wichtigen Lektüre für mich wurden. Ich war stolz darauf, dass ich in eine Hauptschule ging, in der auch Englisch angeboten wurde. Ich habe diese Sprache geliebt und tue es noch immer.
ZEIT: Auf einem Gymnasium hätte es das Fach auch gegeben …
Gruber: Ein Gymnasium war jenseits des Horizonts meiner Eltern. Ihre Arbeiterfreunde hätten gesagt, die Grubers wollen zu hoch hinaus. Zu meinem Glück hatte ich in der Hauptschule einen sehr engagierten Englischlehrer. Er wurde zu einer wichtigen Bezugsperson, war aber auch sehr streng. Es war ein gutes Setting: Die Schule war fair, fördernd und fordernd. Sie versuchte, die Kinder zu ermutigen, das Beste aus sich zu machen.
ZEIT: Wie kam Ihr Vater damit zurecht?
Gruber: Ich wurde erst Lehrer, darauf war er stolz. Anders war es, als ich nach Wien ging. Mein Studium war ihm unheimlich.
ZEIT: Sie haben es vom Arbeiterkind zum Professor in Vergleichender Erziehungswissenschaft gebracht. Wäre ein Bildungsweg wie Ihrer heute noch möglich?
Gruber: Vermutlich viel schwerer. Früher war das Bildungssystem durchlässiger. Wer es heute nicht aufs Gymnasium schafft, von dem nimmt man an, dass er oder sie eine mindere Berufslaufbahn vor sich hat. Dabei sollte ein gutes Schulsystem dafür sorgen, dass alle Menschen gemeinsame Grundfertigkeiten erwerben, die es ihnen erlauben, mündige Bürger zu sein. Es muss aber darüber hinaus die Möglichkeit geben, ein persönliches Bildungsprofil zu erarbeiten.
ZEIT: Sie schreiben im Buch, „wenn es eine pädagogische Lektion enthält, dann die der Ermutigung für junge Menschen, die ‚von unten kommen‘, sich nicht unterkriegen zu lassen“. Ist das System so unfair?
Gruber: Gestern habe ich das Lied Zuckerbäcker von Voodoo Jürgens gehört. Er skizziert darin herzzerreißend das Los der working class, die geringe Wertschätzung, die unmöglichen Arbeitszeiten und so weiter. Es ist für Kinder aus niedrigen sozialen Schichten, wenn sie noch dazu eine dunklere Hautfarbe und einen vermeintlich ausländischen Namen haben, nicht leicht, die Chance zu bekommen, die sie verdienen. Sie dürfen aber nicht aufgeben und müssen, wenn sie scheitern, es ein zweites oder drittes Mal versuchen. Ja, unser soziales System ist unfair.
ZEIT: Wie würde ein gerechteres Bildungssystem aussehen?
Gruber: Die OECD hat 800 Forscherinnen und Forscher nach einer Maßnahme gefragt, die sie im Schulsystem ändern möchten. Zwei Dinge wurden am häufigsten genannt: mindestens zwei Jahre Kindergarten, in dem qualitätsvolle, anregende Lernerfahrungen inszeniert werden. Und ein freudvoller, untraumatischer Schuleintritt vorbereitet wird. Kleine Kinder sind schon sehr lernfähig, das vergessen wir oft.
ZEIT: Und die zweite Aussage?
Gruber: Eine gemeinsame, nicht selektive Schule von der ersten Klasse bis zum Ende der Schulpflicht.
ZEIT: Also im Grunde war damit eine Gesamtschule gemeint.
Gruber: Ja. Niemand ist imstande, das ständische Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert zu rechtfertigen – dennoch wird darüber nicht geredet. Mit zehn Jahren sollen die Kinder fertig entwickelt sein? Natürlich nicht!
ZEIT: Das ist kein Geheimwissen.
Gruber: Ich kann mir auch nicht erklären, warum sich nichts ändert, das ist eigentlich politische Munition. In Frankreich gibt es eine jährliche Publikation, L’etat de l’ecole, über den Zustand der Schulen. Darin werden nationale Daten mit denen einzelner Départements verglichen, zum Beispiel der Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss erreichen oder sitzen bleiben. Regionalpolitiker geraten dann unter Zugzwang, wenn die Erfolgsrate bei ihnen geringer ist. Wenn es in Österreich heißt, dass in der Südsteiermark nur so und so viele Kinder maturieren, zuckt man nur mit den Schultern. Dabei bekommt man in Österreich alle drei Jahre einen sehr guten, aber politisch weitgehend ignorierten Einblick in das Schulleben, nämlich durch die nationalen Bildungsberichte.
ZEIT: Was steht da drin?
Gruber: Ein wiederkehrender Topos ist, dass die Auslese zu früh erfolgt, nämlich schon nach der Volksschule.
ZEIT: Sie sagen, die Politik interessiere sich nicht für diese Berichte. Das war nicht immer so, Bildung war lange Jahre ein zentraler Bestandteil der Regierungspolitik, die Reformen der 1970er-Jahre wirken bis heute nach.
Gruber: Als ich 1964 zu studieren begann, wurde in vielen Ländern die Institution Schule und ihre Rolle im Wohlfahrtsstaat neu definiert. Man hoffte, dass mehr Gerechtigkeit im System die Chancengleichheit in der Gesellschaft erhöhen würde. Dann stellte man fest, dass die außerschulische soziale Ungleichheit sehr mächtig ist. Mein Argument war immer, dass es schon ein großer Beitrag ist, wenn das Schulsystem die Ungleichheit nicht verstärkt und zumindest graduell verringert.
ZEIT: Verdankt die Generation der Boomer ihren sozialen Aufstieg den Kreisky-Jahren?
Gruber: Ja. Und dann ist etwas gekommen, was man in Deutschland die Tendenzwende genannt hat. Der Reformwille ließ nach, der Neoliberalismus hielt Einzug. Der Staat wurde aus der Verantwortung entlassen, für Fairness in der Gesellschaft zu sorgen. Heute ist einer der politischen Schlüsselbegriffe die Eigenverantwortung – der mündige Bürger soll selbst schauen, wo er bleibt.
ZEIT: Die Verantwortung wurde abgegeben?
Gruber: Es gibt den schönen Satz von Herrn Faßmann …
ZEIT: Heinz Faßmann war von 2017 bis 2021 ÖVP-Bildungsminister.
Gruber: Er hat gesagt, er lasse sich nicht den Rucksack der Gesamtschule umhängen. Aber was heißt das? Er war als Minister für das gesamte Schulsystem zuständig und verantwortlich, auch für die Strukturfrage!
ZEIT: Neue Ideen haben es in Österreichs Bildungspolitik mittlerweile schwer, siehe die Ganztagsschule, von Gegnern oft als „Zwangstagessschule“ verballhornt …
Gruber: Und die Gesamtschule „Einheitsschule“. Die Sprache ist verräterisch. Es gibt einen unterentwickelten Diskurs über Bildungsfragen, man will sich gar nicht darauf einlassen, welche Reformen zum Beispiel die OECD empfiehlt. In etlichen Ländern gibt es nationale Kommissionen, die die Regierungen entlasten, in denen darüber nachgedacht wird, wie es weitergehen könnte. In England und Schweden saßen in diesen Kommissionen immer Erziehungs- und Sozialwissenschaftler, aktive Lehrerinnen und Lehrer und ein paar Politiker. Die Wissenschaftler haben das gesicherte Wissen vorgetragen, die Lehrer haben gesagt, was davon machbar ist, und die Politiker, ob das finanzierbar und umsetzbar ist. Politik, Wissenschaft und Praxis haben sich vor Reformen zum Teil über Jahre hinweg abgestimmt.
ZEIT: Und in Österreich?
Gruber: Ach, allein bei der Beschickung von Kommissionen mit Expertinnen und Experten wurde früher dafür gesorgt, dass drei Rote und drei Schwarze drinnen sitzen – so konnte man immer streichen, was die anderen gesagt haben.
ZEIT: Sie kennen nicht nur die Probleme in Österreich, Sie haben auf der ganzen Welt Schulen besucht. Was hat Sie am meisten überrascht?
Gruber: In Japan habe ich eine starke Kontrolle des Lerngeschehens erlebt. Gleichzeitig sind die Lehrer sehr engagiert – in Österreich würde das als Selbstausbeutung gelten. Sie übernehmen Klassen in dem Bewusstsein, dass sie keinen Schüler verlieren möchten. Dass jemand sitzen bleibt, kommt so gut wie nicht vor.
ZEIT: Der Lehrerberuf ist hoch angesehen?
Gruber: Das hat mit der konfuzianischen Wertschätzung von Lernen zu tun. Das Wort sensei heißt nicht nur Lehrer, sondern auch: verehrungswürdiger alter, weiser Mensch. In Japan fühle ich mich sehr wohl mit meiner Liebe zur Schule, weil die Gesellschaft diese Institution als hohes Gut sieht.
ZEIT: In Österreich gehören die Lehrer nicht zur beliebtesten Berufsgruppe.
Gruber: Das bekümmert mich sehr.
ZEIT: Woran liegt denn dieser schlechte Ruf?
Gruber: Das hängt auch mit der frühen Auslese zusammen. Beim Versuch, objektiv zu sein, werden mittlerweile nicht nur die Noten der vierten, sondern auch der dritten Volksschulklasse mit einbezogen. Lehrerinnen und Lehrer sind unbeliebt, weil sie Prognosen machen müssen, die völlig unzuverlässig sind. Dazu kommt die Rekrutierung der Lehrerinnen- und Lehrerschaft. Da müssen die Universitäten und Lehrerbildungsanstalten viel stärker in die Pflicht genommen werden. Wir dürfen nicht jeden, der gleichzeitig gehen und pfeifen kann, sofort in eine Klasse stellen, sondern müssen darauf achten, dass diese Leute drei Bedingungen erfüllen: Sie müssen Kinder mögen, ihr Fach beherrschen und unterrichten können.
ZEIT: Als Bremser der meisten Schulreformen gilt die Lehrergewerkschaft.
Gruber: Ja.
ZEIT: Zu Unrecht?
Gruber: Nein. Die deutsche oder die englische Lehrergewerkschaft haben eigene Thinktanks, die sich Gedanken über grundlegende Fragen machen. In Österreich ist die Funktion dieser Gewerkschaft stark auf das Dienstrecht fokussiert und auf die Aufrechterhaltung „wohlerworbener“ Rechte. Die Frage ist oft nicht: Ist etwas pädagogisch wertvoll, sondern: Ist das durch Vorschriften abgesichert und ja, leider: Wird es extra abgegolten? Mit so einem Zugang geht viel faszinierendes Lernen verloren.
ZEIT: Herr Gruber, lieben Sie die Schule heute noch?
Gruber: Ich muss gestehen, dass es heute eher die Vision einer gerechten, humanen Schule ist, die mich begeistert – und weniger das, was ich so vorfinde.
KARL HEINZ GRUBER
Das Arbeiterkind
Am 15. April 1942 wurde Karl Heinz Gruber in Laakirchen in Oberösterreich geboren. Er besuchte die Hauptschule, anschließend die Lehrerbildungsanstalt und unterrichtete unter anderem an einer Zwergschule im Innviertel.
Der Professor
Ab 1964 studierte Gruber Pädagogik, Soziologie und Völkerkunde an der Universität Wien. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wurde 1986 habilitiert. Er lehrte und forschte unter anderem an den Universitäten Oxford, Harvard und Hiroshima.
Der Autor
Gruber hat zahlreiche Beiträge für die ZEIT und den Standard geschrieben sowie mehrere Bücher. Zuletzt erschien in der Bibliothek der Provinz seine Autobiografie Vergnügte Wissenschaft.
(Karl Heinz Gruber im Interview mit Florian Gasser in der Zeit Nr. 52/2022, online erschienen am 19. Dezember 2022)
https://www.zeit.de/2022/52/oesterreichisches-schulsystem-ungerechtigkeit
Rudolf Mitlöhner: Du holde Wissenschaft: Pädagogische Bekenntnisse
Autobiografische Notizen des Erziehungswissenschaftlers Karl Heinz Gruber.
Einen „pädagogischen Selbstversuch“ nennt Karl Heinz Gruber, ehemaliger Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Uni Wien, seine autobiografischen Notizen. Sie bestechen insbesondere durch ihre Leichtigkeit, ihren Humor und den Hang des Autors zu Selbstironie und Understatement. Zudem ist Gruber ein großer Musikliebhaber und -kenner. So erzählt er etwa, wie er als Gastprofessor in Hiroshima in der Privatwohnung des Rektors auf dessen Wunsch Schuberts „Du holde Kunst“ zum Besten zu geben hatte.
Mit Augenzwinkern beschreibt Gruber seinen Weg von einer „proletarischen Kindheit“ (der Vater arbeitete in der Papierfabrik Steyrermühl) über sein Lehrer-Dasein bis hin zur akademischen Karriere.
Dass er bei alldem auch eine politische Agenda hat, verhehlt der deklarierte Alt-68er nicht: das Buch will eine „Ermutigung für junge Menschen“ sein, „die ‚von unten kommen‘, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern alles daran zu setzen, ‚to outsmart an unfair social system‘“.
(Rudolf Mitlöhner, Rezension im Kurier, online erschienen am 5. Feber 2023)
https://kurier.at/kultur/du-holde-wissenschaft-paedagogische-bekenntnisse/402314573
ORF Radio Ö1-»Leporello«: Forschung mit Vergnügen
Karl Heinz Gruber, Doyen der Erziehungswissenschaft in Österreich, legt stets Wert darauf, seine Einsichten und Erkenntnisse auf ebenso lehrreiche wie vergnügliche Weise vorzutragen. Als Professor an der Uni Wien, aber auch als Forschender und Lehrender in Oxford, Harvard und Hiroshima hat Gruber Tausende Studierende inspiriert, belehrt und: unterhalten. Im Verlag „Bibliothek der Provinz“ legt der 81-Jährige nun seine Autobiografie vor – ihr programmatischer Titel „Vergnügte Wissenschaft“. Und dem Anspruch des Autors gemäß ist das Buch durchaus vergnüglich zu lesen.
(Ankündigung zur Ö1-Sendung »Leporello« vom 9. Feber 2023, Gestaltung des Beitrags: Günter Kaindlstorfer)
https://oe1.orf.at/programm/20230209/708706/Forschung-mit-Vergnuegen
Christoph Winder: Biografie und Wissenschaft mit Witz
Bildung, Wissen, Leben: Karl Heinz Grubers Buch „Vergnügte Wissenschaft. Ein pädagogischer Selbstversuch“.
Karl Heinz Gruber ist STANDARD-Leserinnen und -Lesern wohl bekannt. Viele Jahre hindurch hat der ehemalige Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Uni Wien höchst sachkundige und erhellende Beiträge für diese Zeitung geschrieben und einem österreichischen Laienpublikum (und Fachleuten) lehrreiche Blicke auf schulische Verhältnisse jenseits der nationalen Grenzen ermöglicht.
In seiner langen akademischen Tätigkeit hat Karl Heinz Gruber konkrete Erziehungsrealitäten in Schweden, Frankreich, Japan, Großbritannien und den USA studiert, oft nach dem „Fly on the Wall“-Prinzip, als stillschweigender, aber präzise wahrnehmender Beobachter dessen, was sich in Klassenzimmern rund um den Erdball abspielte und für die Verbesserung der einschlägigen hiesigen Systeme nutzbar gemacht werden konnte.
Nun hat Gruber, der seit 2003 emeritiert ist, aber bis 2020 an verschiedenen Universitäten weiterlehrte, den Fundus seiner STANDARD-Beiträge ergänzt und zu einem kleinen, feinen Büchlein mit dem Titel Vergnügte Wissenschaft zusammengestellt (die Fröhliche Wissenschaft war schon an Nietzsche vergeben).
Von ziemlich weit unten
Es ist autobiografischer Natur, erschöpft sich jedoch nicht in einer selbstbezogenen Lebensbeschreibung, sondern vermittelt auch viel Wissen über Eigenheiten und Usancen an diversen Erziehungsstätten, seien es nun Weltklasseuniversitäten wie Oxford oder Stanford oder bescheidene ländliche Volksschulen im Oberösterreich der 1960er, wo Grubers Karriere ihren Ausgang nahm. Der Stolz und die Freude des Autors über einen Lebenslauf, der ihn, eine sozial oft auch schwierige Sache, „von ziemlich weit unten nach ziemlich weit oben“ gebracht hat, ist dem Buch auf jeder Seite anzumerken.
Es lässt sich als eine Hommage an die Mühe, das Vergnügen und den Lohn des Sich-Bildens lesen, eine Tätigkeit, von der Gruber von Jugend an fasziniert war und die es ihm ermöglicht hat, aus den bescheidenen Umständen eines oberösterreichischen Arbeiterhaushalts in lichte akademische Höhen emporzusteigen: sechs Jahre in Oxford, Gastprofessuren in aller Herren und Damen Länder, Chairman des OECD-CERI in Paris, „dem wichtigsten und mächtigsten internationalen Gremium für Bildungsforschung und Schulentwicklung“, und so fort. Nicht all seine Karriereschritte schreibt sich Karl Heinz Gruber als eigenes Verdienst zu. Er lernte Mentoren wie den Oxford-Germanisten Jim Reed kennen oder den mit eminentem Wissen über das Schul- und Universitätswesen der englischsprachigen Welt ausgestatteten Erziehungswissenschafter David Phillips. Diesen und anderen Förderern und Freunden widmet Gruber ein eigenes Kapitel.
Ohne Imponiergehabe
Gruber schreibt unterhaltsam und witzig, fachchinesisch verbrämtes Imponiergehabe liegt ihm fern. Als überzeugter Anglophiler hängt er der Denkschule der „joking seriousness“ an, wonach ein Text, ein Vortrag, ein Kommentar zugleich wissenschaftlich korrekt und unterhaltsam sein kann.
Er liebt das Bonmot, die prägnante, knappe Formulierung, Witz, Ironie und die Anekdote (manche davon mit unerwartetem Personal wie dem Wiener Großbäcker Johann Ströck, den Gruber bei einem Spitalsaufenthalt als Bettnachbarn kennenlernt). Die Leichtigkeit und Frische der Darstellung macht die „Vergnügte Wissenschaft“, die Karl Heinz Gruber betrieben hat, nicht nur zu einem Vergnügen für ihn, sie ist es auch für seine Leserschaft. […]
(Christoph Winder, Rezension in der DerStandard-Beilage „Album“ vom 11. Februar 2023, S. A7)
https://www.derstandard.at/story/2000143408342/karl-heinz-gruber-biografie-und-wissenschaft-mit-witz
Heidi Schrodt: Auf der Suche nach dem idealen Schulsystem
Warum fördern Österreichs Schulen Kinder nicht besser? Karl Heinz Gruber erklärt es in einem autobiografisch inspirierten Buch
Wenn Karl Heinz Gruber, international renommierter Erziehungswissenschaftler, anlässlich seines 80. Geburtstags eine kleine Autobiografie verfasst, so ahnt man gleich, dass sich diese nicht auf seinen Werdegang beschränken wird.
Karl Heinz Gruber, und dazu bekennt er sich durchaus, hatte immer auch eine politische Agenda. Dafür ist er in Österreich außerhalb der akademischen Welt ebenfalls bekannt und geschätzt. „Vergnügte Wissenschaft“ titelt er sein Buch. Vergnüglich liest es sich.
Karl Heinz Gruber, Jahrgang 1942, stammt aus einer oberösterreichischen Arbeiterfamilie. Sein Vater war Papiermacher in einer Fabrik und musste noch als Zwölfjähriger die Schule verlassen, um als Knecht zu arbeiten. Karl Heinz war ein sehr guter Schüler. Allem voran nennt er seinen Englischlehrer an der Hauptschule als „das größte Glück meiner gesamten Bildungskarriere“. Dieser empfahl Grubers Eltern den Übertritt an die zur Matura führende Lehrerbildungsanstalt. So kam es also, dass er zum Pflichtschullehrer ausgebildet wurde.
Ein Fulbright-Stipendium in Minnesota sollte schließlich eine Wende in seiner weiteren beruflichen Laufbahn darstellen, denn nach seiner Rückkehr entschloss er sich zu studieren und inskribierte an der Universität Wien Pädagogik, Soziologie und Völkerkunde. Schon im zweiten Semester wurde er am Pädagogischen Institut angestellt, seine Dissertation verfasste er über die schwedische Schulreform 1962, seine Habilitation über Vergleichende Erziehungswissenschaft, seinen Forschungsschwerpunkt.
Seine beruflichen Stationen spiegeln den internationalen Fokus wider. 1986 wurde er zum Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Universität Wien berufen und öffnete uns so erstmals den Blick über die österreichischen Grenzen hinweg. Prägend waren dann für ihn die Jahre am St. John’s College in Oxford sowie seine wissenschaftliche Tätigkeit bei der OECD in Paris. Eine Gastprofessur an der Universität von Hiroshima eröffnete ihm die Möglichkeit, das japanische Schulsystem an der Basis zu erforschen.
Als Leitmotiv seiner wissenschaftlichen Arbeit nennt K. H. Gruber die Frage: Wo gelingt schulisches Lernen erfolgreicher, befriedigender, besser und glücklicher? Es sei ihm nicht möglich, einem bestimmten Schulsystem das Prädikat „bestes der Welt“ zu verleihen, doch gebe es eine Reihe von best practices, die es hervorzuheben lohnt.
Das wäre etwa die École maternelle, die französische Vorschule, oder die kindzentrierte, offene Infant School in England für die Fünf- bis Siebenjährigen. Für die Grundschule könnte Japan Vorbild sein, wo sich Lehrer persönlich für jedes Kind verantwortlich fühlen und jedes Kind ein Musikinstrument lernt. Bis vor wenigen Jahren wäre die schwedische Mittelstufe Vorbild gewesen, doch durch die Privatisierung des Schulsystems ist viel Qualität verlorengegangen. Finnland wird stattdessen als best practice genannt.
Das Internationale Baccalaureat sieht er für die Oberstufe als vorbildlich an. Es wäre nicht K. H. Gruber, wenn er nicht hinzufügte, dieser internationale Schulvergleich sei „nicht (ganz) ernst gemeint“.
Was dieser erfahrene Forscher uns zu sagen hat, ist selbstverständlich sehr ernst zu nehmen. Seit Jahren setzt er sich in Österreich für eine andere, zeitgemäße Schule ein, die selbstverständlich eine gemeinsame ist. Warum eine Schulreform in Österreich so wichtig wäre, erschließt sich bei der Lektüre dieses „pädagogischen Selbstversuchs“ wie von selbst.
(Heidi Schrodt, Rezension im Falter #16/23 vom 21. April 2023, S. 19)
Klaus Buttinger: Aufstieg und Urteil des Karl Heinz Gruber
Einen „pädagogischen Selbstversuch“ nennt Karl Heinz Gruber seine „Fragmente einer akademischen Karriere“, als würde er sich vor dem Begriff Autobiografie fürchten. Dabei ist es eine, und eine höchst unterhaltsame noch dazu. In „Vergnügte Wissenschaft“ beschreibt der ehemalige Ordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Uni Wien seinen Werdegang, der so gar nicht einer heutigen universitären Karriere gleicht.
Aufgewachsen in einer Arbeitersiedlung in Steyrmühl profitiert er von der 1968-Aufbruchsstimmung und den chancenangleichenden Schulreformen Kreiskys. Er wird Lehrer in einer zweiklassigen Volksschule im Sauwald. Der Zufall führt ihn in die Erziehungswissenschaften, die Neugier nach Schweden, in die USA und nach Oxford. Schließlich wird er Professor an der Uni Wien und Vorsitzender des Centre for Educational Research and Innovation des OECD-Bildungsgremiums in Paris. Er ist am Olymp.
Gruber berichtet profund von den Vor- und Nachteilen der Schulsysteme. Und obwohl er im System ganz oben war, sagt er es dem System hinein. Ein lehr- und anekdotenreiches Büchlein.
(but, Rezension im Magazin der Oberösterreichischen Nachrichten vom 10. Juni 2023, S. M7)
