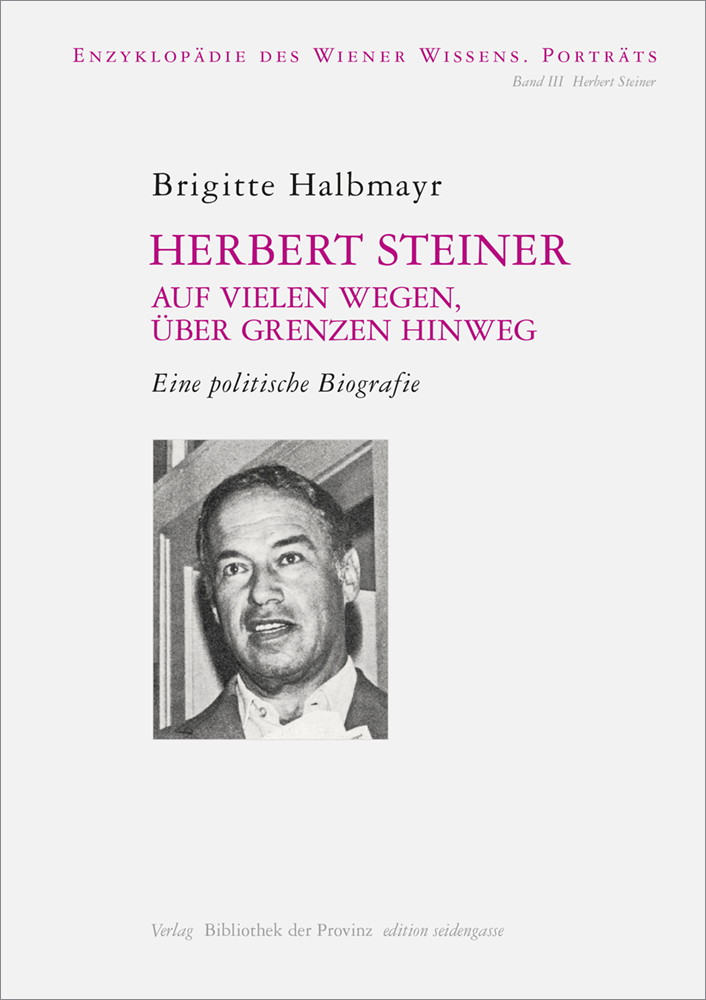
Herbert Steiner – Auf vielen Wegen, über Grenzen hinweg
Eine politische Biografie
Brigitte Halbmayr, Herbert Steiner
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener Wissens: PortraitsISBN: 978-3-99028-519-0
21×15 cm, 336 Seiten, zahlr. S/W-Abb., Hardcover
25,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Österreich hat sich Jahrzehnte lang um eine Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus gedrückt.
Einer der wenigen, die früh schon tatkräftig gegen das Vergessen gearbeitet haben, war Herbert Steiner (1923–2001). Mit der Gründung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes bereits in den 1960er Jahren hat er dafür eine langfristig wirkungsvolle Institution geschaffen. Dabei ging es ihm nicht nur um die Geschichte des Widerstands, sondern auch um die Dokumentation der verschiedenen Opfergruppen sowie des Ausmaßes nationalsozialistischer Verfolgung.
Bereits während seiner Zeit im englischen Exil (ab Ende 1938) entfaltete Steiner als Sekretär der Jugendorganisation Young Austria eine intensive politische und kulturelle Tätigkeit, die er nach dem Krieg weiter ausbaute. So reichte seine Förderung des Jura Soyfer-Gedenkens bis in die London-Jahre zurück, ebenso wie seine intensive Netzwerkarbeit viele internationale Kontakte ermöglichte.
Vor dem Hintergrund seiner kommunistischen Überzeugung, die allerdings im Laufe seines Lebens immer brüchiger wurde, engagierte sich Herbert Steiner im wissenschaftlichen Austausch zwischen West- und Osteuropa. In Erinnerung bleiben zudem seine Leistungen in der Erforschung der österreichischen Arbeiterbewegung und der Revolution von 1848.
Die vorliegende politische Biografie zeichnet diesen denkwürdigen Lebensweg nach. Sie macht deutlich, wie es über parteipolitische Grenzen hinweg gelingen kann, Verbündete im antifaschistischen Engagement zu gewinnen und breite Allianzen im Einsatz für Demokratie und Aufklärung zu bilden.
Der Name Herbert Steiner ist untrennbar mit der Gründung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) im Jahr 1963 verbunden. Im Österreich der frühen 1960er-Jahre unternahm er damit einen wichtigen Schritt zur Sicherung und Aufarbeitung von Zeugnissen der nationalsozialistischen Vergangenheit – nicht nur, was den von ÖsterreicherInnen geleisteten Widerstand betrifft, wie der Name suggerieren mag, sondern auch hinsichtlich der Beteiligung an nationalsozialistischen Verbrechen. Das DÖW war zudem von Beginn an eine überparteiliche Institution. Dies lässt sich sowohl an seinen Arbeitsschwerpunkten als auch an der Zusammensetzung der Vorstände und an den Kuratoriumsmitgliedern ablesen.
Mit dem Namen Herbert Steiner verbinden sich aber auch eine intensive politische und kulturelle Tätigkeit im englischen Exil in der Organisation „Young Austria“, deren Sekretär er ab 1941 war, und die Förderung des Jura Soyfer-Gedenkens, das ebenfalls bis in diese Jahre zurückreicht. Er steht für eine lebenslange kommunistische Überzeugung, die allerdings zunehmend brüchig wurde; für seine wichtigen Leistungen im wissenschaftlichen Austausch zwischen West- und Osteuropa; für sein außerordentliches Interesse an der Erforschung der österreichischen Arbeiterbewegung und der bürgerlichen Revolution 1848.
Dies alles und noch viel mehr wird in der Biografie über Herbert Steiner nachgezeichnet und kritisch gewürdigt. Auch seine Kindheit im Wiener Alsergrund, seine frühe Politisierung und die Ende 1938 erfolgte Flucht nach England kommen darin ausführlich zur Sprache. Zahlreiche Interviews mit ehemaligen WeggefährtInnen aus den unterschiedlichen Lebensabschnitten Herbert Steiners, sein Nachlass sowie seine wissenschaftlichen Arbeiten und Herausgeberschaften dienten als Grundlage für dieses Werk.
[Enzyklopädisches Stichwort]
[edition seidengasse · Enzyklopädie des Wiener Wissens : Porträts, Bd. III |
Begründet 2003 u. hrsg. von Hubert Christian Ehalt für die Wiener Vorlesungen, Dialogforum der Stadt Wien]
Rezensionen
Hans Hautmann: [Rezension]Herbert Steiner war als Historiker der Arbeiterbewegung, Gründer des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), Mitbegründer der Linzer Konferenzen der ITH, Universitätslehrer, Bibliograph, Sammler und Anreger einer der wichtigsten Vertreter der linken, antifaschistischen Geschichtsszene in der Zweiten Republik. Die Beschreibung seines Lebensweges und seiner bedeutenden Leistungen war längst fällig und liegt nun mit dem Buch von Brigitte Halbmayr vor. Es umfasst das gesamte Spektrum seines Werdeganges und Wirkens, von der Kindheit in Wien, der Flucht als 15-Jähriger nach England im Dezember 1938, der Tätigkeit in der Exilorganisation Young Austria, der Rückkehr nach Österreich 1945, der Zeit als Bundessekretär der Freien Österreichischen Jugend und Funktionär der KPÖ, der Periode als wissenschaftlicher Leiter des DÖW und seiner vielfältigen anderen Aktivitäten in den 1960er bis 1990er Jahren bis zu seinem Tod am 26. Mai 2001. Die Darstellung Brigitte Halbmayrs ist sorgfältig recherchiert, fußt auf einer breiten Quellenbasis von einschlägiger Literatur, Interviews und Selbstzeugnissen, hat einen umfangreichen, textlich sehr instruktiven Anmerkungsapparat und ist gut geschrieben. Von besonderem Wert ist die im Anhang beigefügte Liste der Schriften Herbert Steiners, ein Werkverzeichnis, das den ganzen thematischen Reichtum seiner Forschungen widerspiegelt.
Am 6. Oktober 2014 führte Brigitte Halbmayr mit mir ein Gespräch, in dem ich ihr meine Erlebnisse mit Herbert Steiner schilderte und das neben vielen weiteren Interviews mit anderen Personen im Buch verarbeitet wurde. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass die Bekanntschaft mit Herbert Steiner ein weichenstellendes Ereignis in meinem Berufsleben als Historiker war. Die Kontaktaufnahme erfolgte, als ich im März 1966 für eine Seminararbeit bei Ludwig Jedlicka über die kommunistische „Rote Garde“ der Jahre 1918/19 Informationen über die dazu vorhandenen Quellen benötigte und ich mich zu diesem Zweck in das Domizil des damals noch jungen DÖW auf dem Fleischmarkt begab. Herbert Steiner empfing mich sehr freundlich und zählte mir auswendig und wie aus der Pistole geschossen die Titel der dazu relevanten Literatur auf, was ich in einer Mischung aus Verblüffung und Bewunderung dankbar entgegennahm. Hier lag eine seiner größten Stärken, die in der monumentalen und wissenschaftlich ungemein wertvollen dreibändigen Bibliographie zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung von 1867 bis 1945, erschienen im Europa-Verlag in den Jahren 1962, 1967 und 1970, Niederschlag fand.
Am Ende des Gesprächs lud Herbert Steiner mich ein, im DÖW mitzuarbeiten, denn ganz unbekannt war ihm der Name Hautmann durch die hohe Funktion meines kommunistischen Vaters in der Wiener Polizei nach der Befreiung 1945 nicht. Ich sagte, durchaus geschmeichelt von dem Angebot, zu und betätigte mich fortan von 1966 bis 1968 jeden Montag und Donnerstag im Archiv. Das Personal des DÖW war zu jener Zeit noch sehr klein und bestand im Wesentlichen aus Herbert Steiner, seiner Sekretärin Johanna Lendwich, Friedrich Vogl, Bruno Sokoll und Selma Steinmetz. Ich war der weitaus Jüngste und wurde als Adlatus von Selma Steinmetz beim Aufbau der Bibliothek eingesetzt, die damals durch allerlei Schenkungen und Nachlässe rasch zu wachsen begann. Dabei sammelte ich nicht nur elementare Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten, sondern lernte darüber hinaus auch viele große, bewunderungswürdige Menschen kennen, die alsantifaschistische Kämpferinnen und Kämpfer das andere, bessere Österreich verkörperten. Herbert Steiner erlebte ich als ungewöhnlich agilen, kommunikativen, immer freundlichen, entgegenkommenden und hilfsbereiten Menschen, der es verstand, vielfältige Kontakte über politische Parteigrenzen hinweg zu knüpfen und das DÖW auf die Position zu heben, die es heute in der österreichischen Wissenschafts- und antifaschistischen Gedenkkulturlandschaft einnimmt. Außerdem war er ein echtes Genie im Geldauftreiben, der schnöden, aber unabdingbaren Grundlage jedweder vereinsmäßiger Institution mit gesellschaftspolitischen Bildungszielen.
Neben Jedlicka war Herbert Steiner sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass ich bald nach meiner Promotion am 13. Dezember 1968 von Karl Rudolph Stadler für die zweite Assistentenstelle neben Gerhard Botz an der Lehrkanzel für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte in Linz ausgewählt wurde. Da der Jägermayerhof in Linz traditionell der Ort der internationalen Tagungen der HistorikerInnen der Arbeiterbewegung war, sind wir uns auch dort noch oft begegnet. Zusammen mit Rudolf Neck spielte er als Organisator der Linzer Konferenzen die Hauptrolle, vor allem als ausgleichender, die Gemüter beruhigender Faktor bei den bisweilen in hitziger Form ausgetragenen Diskussionen der TeilnehmerInnen mit kommunistischer versus sozialdemokratischer Überzeugung.
Die Lektüre von Brigitte Halbmayrs Biographie hat mich an all das erinnert, mir auch neue, bisher unbekannte Einblicke in Herbert Steiners Leben eröffnet und mich darin bestätigt, wie viel ich ihm verdanke. Das Buch ist für alle empfehlenswert, die eine von einem Kommunisten mitgeprägte Periode des Aufbruchs progressiver Geschichtsbetrachtung in Österreich näher kennenlernen wollen.
(Hans Hautmann, Rezension in: Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft, 23. Jg., Nr. 2, Juni 2016, S. 26)
https://www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/AKG_2_16.pdf#page=26
Ina Markova: [Rezension]
Die Textgattung ‚Politische Biografie‘ ist ein zwar nicht boomendes, aber stetig bespieltes Genre der Historiografie. In Österreich sind es vor allem Politiker wie Bruno Kreisky, Christian Broda, Karl Renner oder Engelbert Dollfuß, die in den letzten Jahren porträtiert wurden. Neben diesen Epigonen gerieten auch weniger prominente, nichtsdestotrotz zivilgesellschaftlich relevante Persönlichkeiten in den Blick, die quasi aus der zweiten Reihe heraus das politische Leben der Ersten und Zweiten Republik geprägt haben. 2012 legten etwa Brigitte Halbmayr und Katharina Stengel Biografien über Hermann Langbein vor, der durch sein Wirken als Zeitzeuge und Auschwitz-Chronist bekannt wurde. Halbmayr hat nun eine politische Biografie über Herbert Steiner, den Gründer des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW), verfasst. Ähnlich wie schon in ihrem Buch über Langbein möchte Halbmayr im vorliegenden Werk „hinter geschichtsträchtigen Fakten, abstrakten Zahlen und nüchternen Aktenvermerken den Individuen“ nachspüren, die diese „Einträge in die Annalen ermöglicht haben – weil sie eine Idee verfolgten, ihr Leben einer Aufgabe widmeten, sich aktiv in die Gestaltung von Politik und Gesellschaft einbrachten“ (15). Dabei gilt es, so Halbmayr, individuelle Erlebnisse, Erfahrungen und Entscheidungen in ein gesellschaftspolitisches Umfeld einzubetten (17).
Brigitte Halbmayr schildert die wichtigsten biografischen Stationen in Herbert Steiners Leben in chronologischer Abfolge: Steiner wurde am 3. Februar 1923 in Wien als Sohn jüdischer Eltern geboren. Nach einer Kindheit, die von diversen sozialistischen Organisationen geprägt war, wirkte sich die im Februar 1934 bei vielen SozialistInnen auftretende „große Enttäuschung“ (34) auch auf Steiners Werdegang aus, der 1937 in den Kommunistischen Jugendverband (KJV) eintrat. In den Reihen der kommunistischen Partei sollte Steiner seine politische Heimat finden: Im KJV stieg er bald auf und wurde 1938 politischer Leiter einer KJV-Zelle, im Sommer 1938 war er bereits für mehrere Zellen in seinem Heimatbezirk verantwortlich. Als Jude und Kommunist war Steiner allerdings doppelt gefährdet, sodass er die illegalen politischen Tätigkeiten bald einstellen musste und Mitte Dezember 1938 nach England flüchtete. Steiner führte seine politische Tätigkeit in England nach einer kurzzeitigen Internierung als „enemy alien“ nicht nur fort, sondern intensivierte diese im Rahmen der bedeutenden österreichischen Exilorganisation „Young Austria“ sogar noch.
Nach seiner Rückkehr nach Wien wurde Steiner Bundessekretär der am 16. Mai 1945 gegründeten Freien Österreichischen Jugend, de facto eine Jugend- und Nachwuchsorganisation der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). Weitere Funktionen in der KPÖ folgten: Steiner war ab 1953 Bezirkssekretär der KPÖ Wien-Meidling, im Herbst 1958 übernahm er das Sekretariat der Historischen Kommission der KPÖ und somit realiter ihre Leitung. Diese Tätigkeit deutete, so Halbmayr, bereits Steiners späteren „Quereinstieg in die Wissenschaft“ an (129). 1963 verfasste Steiner an der Karls-Universität in Prag seine Doktorarbeit zum Thema Arbeiterbewegung in Österreich 1867–1889; 1971 wurde sein Titel an der Wiener Universität nostrifiziert. 1982 erhielt Steiner schließlich die Lehrbefugnis für Neuere Geschichte seit dem 18. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiterbewegung.
1957 gründete Steiner mit Rudolf Neck die Arbeitsgemeinschaft für Geschichte der Arbeiterbewegung, was 1964 zur Gründung der Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung führen sollte; Steiner war der langjährige Kassier. Wichtig war hierbei die von Steiner offensiv angestrebte Zusammenarbeit mit sozialdemokratischen HistorikerInnen. Bereits ein Jahr davor war das DÖW in Wien gegründet worden, Steiner sollte dieser Institution bis zu seiner Pensionierung 1983 als Leiter vorstehen. Schon in der Historischen Kommission der KPÖ war es Steiner ein Ziel, eine Sammlung von Dokumenten zum kommunistischen Widerstand anzulegen, eine Tätigkeit, die im DÖW auf alle österreichischen Widerstandsgruppen ausgedehnt wurde. Die Schwerpunkte des DÖW wurden maßgeblich von Steiner mitgeprägt und spiegelten, so Halbmayr, das Bestreben wider, „für das gesamte antifaschistische Österreich zu sprechen und dessen unterschiedliche politische Vorgeschichten gleichberechtigt nebeneinander gelten zu lassen“ (172).
Diesen Versuch der Etablierung des DÖW als überparteiliche Institution nimmt Halbmayr auch zum Anlass, um problematischere Aspekte in Steiners Vita aufzuzeigen: Steiner, so Halbmayr, schwieg zu Konflikten, „zu denen durchaus eine Stellungnahme des DÖW-Leiters erwartet werden konnte“ (178). Als Beispiel hierfür nennt Halbmayr den Kreisky-Peter-Wiesenthal-Konflikt 1975. Auch Steiners Verhältnis zur KPÖ wird von Halbmayr beleuchtet: „Nicht ohne die Partei, aber nicht in ihrer festen Umarmung“ (241) bringt diese Steiners ideologische Haltung, die teilweise durchaus von Enttäuschungen geprägt war (136), auf eine griffige Formel. Dass Steiner der KPÖ dennoch bis zu seinem Tod treu blieb, führt sie zurück auf ein „hohes Maß an Loyalität gegenüber jener Bewegung, die ihm Halt in der Emigration gab, Bildung und Ausbildung ermöglichte, lange Zeit sein finanzielles Auskommen sicherte sowie zahlreiche Kontakte eröffnete“ (245).
Halbmayr zeichnet Herbert Steiner als „Dokumentarist, Wegbereiter, Ermöglicher, Anstifter und Vermittler“ (238) und mit Anton Pelinka als „Meister der politischen Strategie und Seiltänzer im Kalten Krieg“ (246). Diese von durchaus spürbarer Sympathie für das Subjekt/Objekt der Untersuchung getragene Biografie beschäftigt sich einerseits mit der von den Brüchen des 20. Jahrhunderts gezeichneten Vita Steiners. Andererseits und darüber hinaus wirft Halbmayr aber auch einen wichtigen Blick auf die Entstehungsbedingungen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, einer Institution, die einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der NS-Zeit in Österreich geleistet hat.
(Ina Markova, Rezension in: Sehepunkte. Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaften, Ausg. 16 (2016), Nr. 7/8)
https://www.sehepunkte.de/2016/07/28777.html
