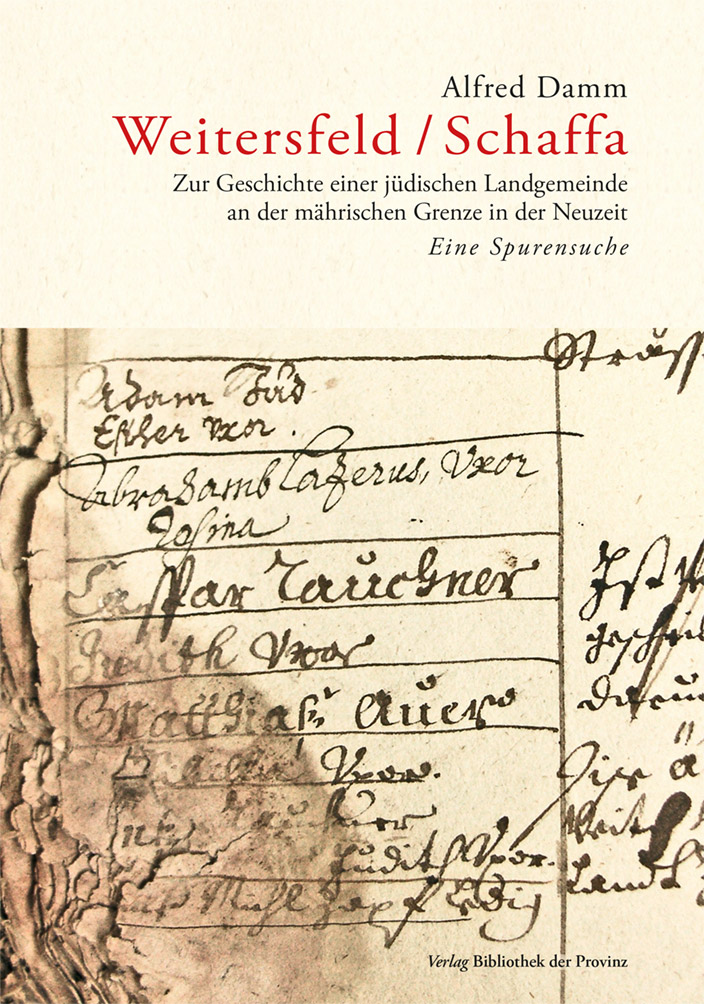
Weitersfeld / Schaffa
Zur Geschichte einer jüdischen Landgemeinde an der mährischen Grenze in der Neuzeit · Eine Spurensuche
Alfred Damm
ISBN: 978-3-99028-072-0
24 x 17 cm, 284 Seiten, zahlr. Abb., graph. Darst., Kt., Hardcover; Text dt., Zsfassungen in engl. und hebr. Sprache
€ 28,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Die steigenden Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse Mitte und Ende des 16. Jahrhunderts motivierten die adeligen Grundherrschaften auch in Niederösterreich, ihre Eigenwirtschaften zu intensivieren; nicht mehr für den Eigenbedarf wurde produziert, sondern für den Verkauf.
Die herrschaftlichen Pfleger, Kastner und Inspektoren waren mit ihrer Arbeit im Herrschaftsbereich vollauf ausgelastet, für den Absatz der grundherrschaftlichen Güter wurden deshalb Vermittler zu den Märkten benötigt. So waren Zwischenhändler z.B. für Getreide gefragt – im Waldviertel allerdings mehr für Schafe, deren Felle und Wolle. Für derartige Aufgaben konnten jüdische Kaufleute mit ihren traditionell weitreichenden Handelsbeziehungen ideal eingesetzt werden. Ein Aspekt, der sicherlich für manche der Wirtschafts-Herrschaften Niederösterreichs der entsprechende Anreiz war, Juden im eigenen Bereich anzusiedeln.
Wenn man sich die Anlagebücher der Jahre vor 1670 ansieht, könnte man den Eindruck gewinnen, Juden wären über das nördliche Niederösterreich geradezu durchdacht und absichtlich verstreut angesiedelt worden. Denn außer einigen Zentren in denen etwa 10–20 jüdische Familien lebten, gab es im 17. Jahrhundert etwa 45 Dörfer mit nur wenigen Juden, zwei bis fünf Familien, vermutlich aber auch Einzelpersonen. Es scheint so, als hätten genügend Grundobrigkeiten Interesse daran gehabt, zwar nicht viele, doch immerhin einige Juden „bei der Hand“ zu haben – zu „halten“ wie die zeitgenössische Diktion lautete – um, genau wie der kaiserliche Hof, deren Geschäftsverbindungen zu nützen. Dazu benötigte der Herrschafts-Besitzer allerdings ein spezielles kaiserliches „Privileg“. So führt Pribram ein Dekret der nö. Regierung aus 1630 an, dass jeder, der auf seinem Gebiet Juden „halte“ den Besitz eines diesbezüglichen Privilegs nachzuweisen hätte. Wer dies nicht könne, sei zu bestrafen und die Juden „abzuschaffen“.
Die rechtliche Stellung der Juden in Niederösterreich in diesem Jahrhundert war unklar, aber meist verhandelbar. Grundsätzlich beanspruchte noch der Landesfürst die Verfügungsgewalt über Juden, er nahm sie unter seinen „Schutz“, d.h. er akzeptierte aus finanziellen Erwägungen ihre Ansiedlung.
Rezensionen
Martin Kugler: Die Pflicht der Juden: Zwei Pfund Pfeffer für den PfarrerEin Sozialhistoriker hat in einem Archiv Akten über die bisher unbekannte jüdische Geschichte im Waldviertel gefunden und ausgewertet.
In Weitersfeld deutet heute nichts mehr darauf hin, dass es im 17. Jahrhundert an der Grenze zwischen Wald- und Weinviertel eine der größten jüdischen Gemeinden Niederösterreichs gegeben hat. Forscher haben in den letzten Jahren etwa in dem Großprojekt „Austria Judaica“ herausgefunden, dass dort 20 jüdische Familien gelebt haben (andere Quellen sprechen sogar von 32). Wer diese Menschen waren, wovon und wie sie lebten, darüber war bisher nichts bekannt. Die Ortschronik widmet der jüdischen Vergangenheit gerade einmal acht Zeilen. Alle innerjüdischen Quellen sind offenbar verloren, ebenso alle Unterlagen zur Ortsgeschichte. Der Sozialhistoriker Alfred Damm stieß bei Recherchen in den Herrschaftsbüchern der Grafschaft Hardegg über das Armenspital in Weitersfeld aber auf Spuren dieser Minderheit, die 1671 zwangsweise in das südmährische Dorf Schaffa (Šafov) gezogen war. Das Ergebnis seiner fünfjährigen Arbeit wurde diese Woche als Buch präsentiert.
Der Beginn der jüdischen Gemeinde ist nicht genau fassbar, die erste Nachricht stammt aus dem Jahr 1619 – wenige Jahre nach einer Vertreibung von Juden aus Wien. Zwei Faktoren sorgten für das Wachstum der Landgemeinde: Zum einen wollten die Hardegger Grafen den Handel mit Agrarprodukten fördern – wegen ihrer verzweigten Kontakte waren Juden dafür gut geeignet. Zum anderen stand (u.a. wegen des Dreißigjährigen Kriegs) die Hälfte aller Häuser leer, den Grundherren war jede Zuwanderung willkommen. Diese ökonomischen Motive waren offenbar viel stärker als die judenfeindliche Haltung der Landesfürsten und der Herrschaftsbesitzer.
Die rechtliche Stellung der Juden war zwar unklar, merkt Damm an – aber sie war verhandelbar. Mit der Herrschaft wurde ein „Contract“ geschlossen, der u.a. die Religionsausübung oder die Zahlung eines „Schutzgeldes“ regelte. So mussten z.B. beim Pfarrer in Weitersfeld jährlich zwei Pfund Pfeffer abgeliefert werden.
Die Juden in Weitersfeld lebten in den zuvor leer stehenden Häusern verstreut im Dorf, ihre Haupttätigkeit war der Handel mit Schafen und Wolle. Manche waren als fliegende Händler („Pinkeltrager“) unterwegs, auch der Kramladen des Ortes wurde von einer jüdischen Familie geführt – dort waren selbst im Kriegsjahr 1646 Safran, Pfeffer oder Feigen zu bekommen. Laut den Akten waren die Weitersfelder Juden zudem agrarisch tätig, obwohl es eigentlich ein Verbot für Juden gab, landwirtschaftlich nutzbaren Grund zu besitzen. Dieses wurde in Weitersfeld offenbar ignoriert – man ging mit Vorschriften aus den weit entfernten Machtzentren recht pragmatisch um.
Nur wenige Quellen
Über das Zusammenleben der protestantischen, später zunehmend katholischen Mehrheitsbevölkerung mit der jüdischen Minderheit gibt es praktisch keine Nachrichten. In den Akten der Grafschaft hat Damm keine Vorwürfe oder Hinweise über „Wucher“ oder „übervorteilende Juden“ gefunden, ebenso wird von keinen Streitigkeiten zu Vieh-, Pfand- oder Leihhandel zwischen Juden und Christen berichtet. „Es hat sicher auch Probleme gegeben, aber diese sind nicht aktenkundig“, so Damm. Gerichtsakten aus dieser Zeit wurden bisher keine gefunden. Es gibt kaum Nachrichten über den Kultus, etwa über eine Synagoge, einen Rabbiner oder einen Friedhof. Genannt sind lediglich Judenrichter und Schulmeister.
1671 veränderte sich die Situation plötzlich dramatisch: Kaiser Leopold I. ordnete die Ausweisung aller Juden Wiens und Niederösterreichs an – „auf ewig“. Die Weitersfelder Juden gingen nach dem Verkauf ihrer Häuser und mitsamt ihres Besitzes in das rund 20Kilometer entfernte Schaffa, knapp hinter der Grenze zu Mähren – wo der kaiserliche Befehl nicht galt. Sie hatten dorthin bereits von früher Kontakte. „Die Umsiedlung war kein Exodus ins Unbekannte. Es war ein simpler Umzug ins nächste Dorf“, so Damm. Der dortige Gutsherr Max von Starhemberg – mit Sitz in Frain (Vranov) – habe den Zuzüglern kein „Asyl“ gewährt, sondern eine Gelegenheit ergriffen, um die Zahl seiner Untertanen zu vergrößern.
In Weitersfeld und Hardegg hinterließ der erzwungene Abzug der Juden eine Versorgungslücke. „Man war gezwungen, den jüdischen Lieferanten nach Schaffa quasi hinterherzulaufen“, schreibt Damm. Dadurch änderte sich an deren Tätigkeit kaum etwas: Sie waren – nun unter der neuen Identität als mährische Juden – weiterhin als Händler u.a. für die Hardegger Grafen tätig.
Die Juden von Schaffa wurden zusehends zu einer bestimmenden Größe im Handel zwischen dem Waldviertel und Mähren. Schaffa selbst war bis in das 20.Jahrhundert hinein halb christlich, halb jüdisch. Die Juden lebten anfangs im Dorf verstreut, bis Kaiser Karl VI. 1726 die „Separierung“ der jüdischen Bevölkerung dekretierte. „Als wirdt hiemit angeordnet, das aus gleichgemelten Haus der Jud von dannen, auf die Juden=seithen translociret werden solle“, heißt es in den Akten. Über das Aussehen des in einer Ecke von Schaffa errichteten Judenghettos informiert ein Vogelschauplan aus 1727/28: Christliche Häuser sind darin rot, jüdische schwarz eingezeichnet.
Dem florierenden Handel der Juden zu Schaffa wurde erst durch den Bau der Eisenbahnen ein Ende gesetzt. Immer mehr Familien wanderten daraufhin in die Städte aus – unter ihnen Vorfahren von Neil Diamond oder Verwandte von Bruno Kreisky. 1943 wurde der letzte jüdische Bewohner von den Nazis deportiert. Vom Ghetto in Schaffa ist heute nichts mehr zu sehen, erhalten ist aber der – gut gepflegte – jüdische Friedhof. Die 950 Grabsteine werden derzeit erforscht. So wird man vielleicht irgendwann erfahren, was aus jenen Juden wurde, die es einst in das tiefe Waldviertel verschlagen hat.
(Martin Kugler, Rezension in der Presse vom 27. Jänner 2013)
https://www.diepresse.com/1337346/die-pflicht-der-juden-zwei-pfund-pfeffer-fuer-den-pfarrer
Schaufenster Kultur.Region: Eiserne Thore
Vom Beginn des Dreißigjährigen Kriegs bis zum Untergang in der Shoah existierte an der österreichisch-mährischen Grenze eine jüdische Siedlung. Bis 1671 im Markt Weitersfeld gelegen, ab dann, aufgrund der von Leopold I. angeordneten Ausweisung, in Šafov/Schaffa, einem Dorf gleich jenseits der mährischen Grenze. Fuhrwerke, Handkarren, Kinder und Gänse, Bauern und Händler müssen wir uns auf den Straßen von Šafov/Schaffa vorstellen. Heute ist Šafov ein verschlafenes Dorf an der Grenze, obwohl es eigentlich ein Städtchen ist. Malerisch die Teiche rundum und die Lage der Friedhöfe – im Süden der christliche, im Westen der jüdische. Beide von Bäumen und Melancholie gesäumt. Bei genauerer Kenntnis des Ortes ist es auch möglich, das jüdische Schaffa ausfindig zu machen: der Nachfolgebau der Synagoge sowie ein, zwei Häuser aus dem Schtetl. In Weitersfeld im Waldviertel ist die Spurensuche weit schwieriger. Der Historiker Alfred Damm wurde in den Herrschaftsbüchern von Hardegg fündig. Die Ansiedelung der von Wien vertriebenen Juden zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde von der Herrschaft forciert, die jüdischen Händler vertrieben agrarische Produkte. Die Herrschaft schloss mit den jüdischen Ansiedlern einen Vertrag, der u. a. die Religionsfreiheit gewährleistete. Andererseits hatten Juden Schutzgeld zu zahlen. Mit der Ausweisung aus Niederösterreich 1671 war die Weitersfelder jüdische Gemeinde gezwungen, eine neue Heimat zu finden – über der Grenze im mährischen Šafov/Schaffa. Zwar sind in den letzten Jahren zur Geschichte der niederösterreichischen Landjuden in der Neuzeit einige grundlegende und umfassende Publikationen erschienen, eine Aufarbeitung der Quellen zu dieser Siedlung fehlt jedoch bisher. Der Autor hat mit akribischen Recherchen in den Archiven diese Lücke geschlossen. Ein schönes Beispiel gelebter Integration vor 100 Jahren ist in den „Heimatkundlichen Blättern des Bezirkes Znaim“ (1899) zu finden. Dort verfassen der christliche und der jüdische Lehrer, Fabian Smrcka und Salomon Riesenfeld, gemeinsam eine Ortschronik von Schaffa: „Die Judenhäuser sind häufig nur 2–3 Fenster breit, ohne Hof, meist einstöckig, mit einer Stiege von der Gasse, mit eisernen Thüren, Thoren und Fensterläden, aus der Zeit herrührend, da die Juden noch Verfolgung zu fürchten hatten. Die Neubauten jedoch entsprechen allen modernen Anforderungen.“
(Rezension in: schaufenster KULTUR.REGION. Nachrichten aus der Kultur.Region Niederösterreich, Mai 2013, S. 44)
