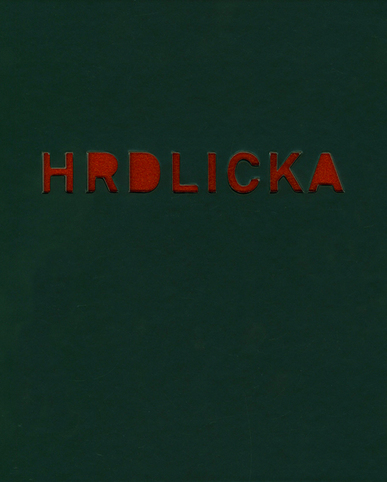
Alfred Hrdlicka – schonungslos!
Alfred Hrdlicka, Agnes Husslein-Arco , Alfred Weidinger
ISBN: 978-3-902416-29-2
28 x 23 cm, XX, 96 S., zahlr. Abb., Hardcover
30,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[Hrsg. von Agnes Husslein-Arco und Alfred Weidinger]
Wie der von ihm verehrte Oskar Kokoschka war Alfred Hrdlicka in jeder Hinsicht eine Doppelbegabung. Vorerst bei Albert Paris Gütersloh und Josef Dobrowsky zum Maler ausgebildet, beschäftige er sich bereits zu einem sher frühen Zeitpunkt mit den künstlerischen Medien der Zeichnung und der Druckgrafik. Gerade die Druckgrafik diente ihm als Ausdrucksträgerin seiner gesellschaftspolitischen Statements und machte ihn weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Seine Entsendung als Vertreter Österreichs zur Biennale in Venedig 1964 verhalf ihm zum internationalen Durchbruch. Die zahlreichen sein Lebenswerk begleitenden Ausstellungen waren entweder bemüht, einen möglichst guten Überblick über die Vielfalt seines künstlerischen Werks zu bieten, oder sie waren thematische Ausstellungen, in denen seine großartige Druckgrafik dominierte.
(Agnes Husslein-Arco)
19 zwischen 1957 und 1981 entstandene Meisterwerke veranschaulichen Hrdlickas künstlerischen Lebensweg. Sein frühester Stein, ein noch bei Fritz Wotruba in der Akademie entstandenes „kubistisches Machwerk“ (Hrdlicka), diente ihm 1959 als Materiallieferant für den in der Ausstellung zwischen den beiden „Schächern“ zu sehenden „Gekreuzigten“, der 1962 im Zusammenhang mit der Eröffnungsausstellung des 20er Hauses von Werner Hofmann erworben wurde. Dieses Werk zeugt einerseits von Hrdlickas künstlerischem Ausgangspunkt bei Wotrubas Skulpturen der späten 1920er-Jahre und andererseits von der sehr persönlichen Verarbeitung der in Wien diskutierten Manierismen der Phantastischen Realisten.
Im 1962 entstandenen „Linken Schächer“ kommt Hrdlickas Kampf gegen die dunklen Seiten menschlichen Handelns deutlich zum Ausdruck. Das zwischen den hochgerissenen Schultern situierte Gesicht des „Rechten Schächers“ allerdings zeigt Hrdlicka gemäß der Überlieferung mit dem Ausdruck eines erlösten Menschen, der, den Schmerz und den Tod duldend, mit der Aussicht auf das Paradies bald zu Ende gelitten haben wird.
Eine im Ausdruck nicht minder bedeutende frühe Skulptur ist Hrdlickas Visualisierung der Massenmörderin „Martha Beck nach der Hinrichtung“ auf dem elektrischen Stuhl. Hoch emporgerichtet erstarrt dieser eben noch angstvoll-lebendige Körper; an den herabgesunkenen Arm gepresst bewahrt das Gesicht den Ausdruck eines zum Stillstand gekommenen Widerstreits von Qual und Glück. Mit der Darstellung des von der Karlsbrücke aus in der Moldau ertränkten böhmischen Priesters Johannes Nepomuk führte Hrdlicka 1980/81 seine auf religiösen Überlieferungen basierende Werkgruppe fort. Er betrachtet die Grenzen zwischen Religion und Politik als fließend und setzte die aus religiösen Motiven resultierende Gewalt der politisch motivierten gleich.
Obwohl Alfred Hrdlicka sich an der Weltpolitik orientierte und diese wortgewaltig kommentierte, konzentrierte er sich in seinem künstlerischen Schaffen auf wenige außerordentliche Motive und Ereignisse, die er immer wieder neu entstehen ließ. Die nur vordergründige Dissonanz zwischen den plakativen und schreienden Themen und der Anwendung manieristischer Züge in der künstlerischen Umsetzung charakterisieren Hrdlickas Werk als das eines hochsensiblen Künstlers, der sich formal am Grat zwischen der aus der Antike schöpfenden Renaissance und dem Barock orientierte, die endgültige Modellierung und den Schaffensprozess aber dennoch und konzessionslos seinem ureigenen Impetus unterwarf.
