
Im Maulwurfshügel
Roman
Helmut Rizy
ISBN: 978-3-99028-221-2
19×11,5 cm, 250 Seiten, Klappenbroschur
20,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Kann Lesen zur Sucht werden wie Alkohol oder Opium? Mit Suchtprävention, Entziehungskur? Wenn es so wäre, müsste doch auf Bucheinbände ein Warnhinweis gedruckt werden: Lesen kann Ihre Gesundheit gefährden oder Ihr soziales Verhalten beeinträchtigen! Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Buchhändler.
Zumindest in den USA müssten Bücher nach mehreren spektakulären Prozessen gegen Verlage längst durch entsprechende Warnhinweise gekennzeichnet sein.
Rezensionen
Kronen Zeitung: [Rezension]Wer etwas von der Welt mitbekommen will, muss sich von dieser manchmal abwenden. In Helmut Rizys Roman „Im Maulwurfshügel“ verabschiedet sich der Held von der Außenwelt und zieht sich in seine Wohnung zurück. Seinen einzigen Überlebenssinn findet er in Büchern, Kontakte zur Außenwelt beschränken sich auf die Besuche einer Hofratswitwe und eines Freundes, der auch dann und wann ein Schnitzel vorbeibringt.
Der witzige Roman des 70-jährigen Autors, der in Bad Leonfelden und Wien lebt und arbeitet, porträtiert einen Lese-Rebellen, der beschlossen hat, sein Dasein in der Welt weniger zum Leben als zum Lesen zu benützen. Oder ist das Lesen einfach nur eine Droge? Ein starkes, humorvolles Buch!
(Rezension in der Kronen Zeitung vom 13. Jänner 2014)
Manfred Chobot: Kann Lesen zur Droge werden?
Der Erzähler ist über siebzig Jahre alt, wie wir im Laufe des Romans erfahren, und heißt Rupert Mayrhofer. Früher ging er regelmäßig zum Stammtisch, traf dort seine Freunde, die eigentlich keine Freunde waren, denn man saß bloß zusammen und quatschte, das Private blieb weitgehend ausgeklammert. Noch früher war er Anwalt, nämlich einer, der sich für arbeitsrechtlich Benachteiligte einsetzte, um ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Als Anwalt wollte er nie „nach Höherem streben“, hatte keine Ambitionen, ein „Staranwalt“ zu werden. „Streber war ich auch in der Schule keiner gewesen“, weshalb er von manchen Kollegen belächelt wurde. Was aber nicht bedeutete, dass er ohne Ehrgeiz oder Ambitionen war, „bloß für meine Ellbogen entwickelte ich keine Taktik.“
Eines Tages stellte er fest, dass er eine erkleckliche Anzahl seiner Bücher noch nicht gelesen hatte. Bücher, die ihn interessierten oder die ihm jemand empfohlen hatte – schließlich hatte er sie gekauft, um sie irgendwann einmal zu lesen. Jedoch aus allerlei Gründen war es bisher nicht dazugekommen: „Der Mann ohne Eigenschaften“ hatte ihn wegen seines Umfangs geschreckt, auf manche Bücher hatte er vergessen, sodass sie in seinem Bücherregal Staub ansetzten. Immerhin hatte er auch andere Dinge in seinem Leben zu erledigen, wurde von so manchem abgelenkt, sich dem Lesen zu widmen.
Bis er die Entscheidung traf, dem Stammtisch fernzubleiben und stattdessen zu lesen. Lebensmittelvorräte lagerten tiefgekühlt, demnach musste er seine Wohnung nicht verlassen. Da er nicht den ganzen Tag lesen konnte, begann er, ein Tagebuch zu verfassen. Mit dem „Mann ohne Eigenschaften“ eröffnete er sein Leseritual. Ein Buch, das man gelesen haben musste – oder wenigstens behaupten sollte man, es gelesen zu haben. Seine Nachbarin, die Hofratswitwe, lud ihn ein zu Kuchen und Kaffee, damit er ihr erzähle, worum es in diesem Buch ging. Sie erwartete sich eine Zusammenfassung, zu der sich Rupert aber nicht imstande fühlte, denn inzwischen war er bereits bei Stendals „Rot und Schwarz“ angelangt, hatte vom eigenschaftlosen Mann lediglich den ersten Band bewältigt.
Schon bald stellte Rupert sich die Frage: „Ist das Lesen nicht eine Art von Droge? Sollte auf den Einbänden nicht ein warnender Hinweis stehen: Lesen kann Ihre Gesundheit gefährden oder Ihr soziales Verhalten beeinträchtigen! Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Buchhändler. Zumindest in den USA müssten Bücher nach mehreren spektakulären Prozessen gegen Verlage längst durch entsprechende Warnhinweise gekennzeichnet sein.“
Also notierte er: „Wo liegt der Unterschied zwischen einem Opiumraucher und einem Leser? Beide entfliehen ihrer konkreten Umgebung und tauchen in eine andere Welt ein, in der Hoffnung, es wäre eine bessere. Eskapismus. Auf den Opiumraucher – ich habe hier zwar keine einschlägigen Erfahrungen – mag es zutreffen, dass er für die Zeit seines Rausches der Realität seines Lebens entfliehen will; ich hingegen kehre gern aus Kakanien wieder in meine Wohnung zurück.“
Dann und wann besuchte ihn sein Stammtisch-Freund Fritz, weil sich die Stammtischler Sorgen um ihn machten. Um zu demonstrieren, dass sie ihn nicht vergessen hatten, brachte Fritz immer wieder ein Schnitzel vom Stammtisch mit, dazu ein paar Flaschen Wein.
Rupert hatte inzwischen von Jorge Amado „Der große Hinterhalt“, von Alejo Carpentier „Le Sacre du printemps“ und von Klaus Mann „Der Vulkan“ hinter sich gebracht, gegen den er einiges einzuwenden hatte, als ein Stammtisch-Kumpel ins Spital eingeliefert wurde und ein Besuch angesagt war, obwohl er den Kollegen eigentlich nie gemocht hatte. Nachdem Rupert „Franziska“ von Ernst Weiß und „Kindheit“ von Nathalie Sarraute gelesen hatte, stand das Begräbnis des ihm unsympathischen Kollegen, der immer gegen Ausländer geredet hatte, auf dem Programm, und schon wieder musste Rupert seinen „Maulwurfshügel“ temporär verlassen.
Mit Frauen hatte es in Ruperts Leben nie so richtig geklappt, eine Geliebte war zu einem Kollegen übergewechselt, eine andere, sie war Apothekerin, hatte sich auf einer Tagung von einem Peruaner schwängern lassen. Dafür entwickelte sich die benachbarte Hofratswitwe mehr und mehr zu Ruperts Kontaktperson. Gewissenhaft notierte er in seinem Tagebuch, was er gelesen und geträumt hatte. Zudem sickern immer wieder Details seines Lebens durch, dass er Pianist werden wollte, dass er das Erbe seines Vaters abgelehnt hatte, nachdem dieser – ohne den Sohn zu informieren – das Elternhaus verkauft hatte und in ein Altersheim übersiedelt war. „Einige Tage lang ärgerte ich mich, überlegte, ob ich nicht nachhause fahren sollte, um zu schauen, was sich noch finden ließe, verwarf dann aber glücklicherweise den Gedanken… Mutters Schmuck interessierte mich nicht, schon gar nicht das Bleikristall.“
In Samuel Becketts „Molloy“ schien ihm, dass es sich dabei um seine eigene Geschichte handelte. Da Rupert seine Bücher stets als etwas Wertvolles betrachtete – Leute, die anstatt ein Lesezeichen zu verwenden, Eselsohren in ihre Bücher machen, waren ihm zuwider –, überlegte er auch, wer nach seinem Ableben seine Bibliothek erben sollte. Die Hofratswitwe kam aufgrund ihres Alters nicht infrage, sehr wohl aber als Bewahrerin seines Testaments. Womöglich die Studenten, die im Stockwerk über ihn wohnten?
Bei Jean Pauls „Siebenkäs“ brechen Ruperts Aufzeichnungen ab. In einem Nachspann erfahren wir, dass eine Studentin das Erbe antrat und sein Tagebuch für lesenswert erachtete. Tatsächlich ist Helmut Rizys Roman über einen Dauerleser nicht nur amüsant, vielmehr eine Parabel über ein Leben zwischen und mit Büchern.
(Manfred Chobot, Rezension in: Driesch. Zeitschrift für Literatur & Kultur Nr. 17/2014, S. 86 f.)
Helmuth Schönauer: [Rezension]
Wer etwas von der Welt mitbekommen will, muss sich von dieser manchmal abwenden.
In Helmut Rizys Roman „Im Maulwurfshügel“ hat sich der Held von der Außenwelt verabschiedet und sich in seine Wohnung zurückgezogen. Er versucht dabei, ein strukturiert sinnvolles Leben mit sich selbst und seinen Büchern zu finden. Die beiden letzten Kontakte sind eine etwas hoch polierte Hofratswitwe von nebenan und der Freund Fritz, der fallweise frische Schnitzel oder eleganten Schnaps zum Überleben mitbringt.
Während sich der Ich-Erzähler gleich einmal an Musils Mann ohne Eigenschaften die Daseinszähne ausbeißt, sickert seine Kurzbiographie durch. Er ist als Anwalt Rupert Mayrhofer in Ruhestand getreten und hatte es nur kurzfristig mit Frauen zu tun. Einmal ist ihm die Geliebte zu einen Anwaltskollegen übergesprungen, ein andermal hat ein Verhältnis zu einer Apothekerin dazu geführt, dass sie von einem Peruaner ein Kind bekommen hat.
Diese einfache und an die Kühnheit eines Essays erinnernde Hormonlage des erzählenden Lesers bringt ihn sofort mit der Figuren-Lage Musils auf Augenhöhe.
Beim Lesen entstehen offensichtlich zwei Geschichtskreise, jene im Text und jene im Leser. Wenn nun der Leser sich nicht vom Leben ablenken lässt und sich völlig auf das Lesen reduziert, bleibt naturgemäß der Geschichtskreis aus dem Text in besserer Erinnerung.
Der Ich-Erzähler liest sich durch seine Bibliothek der ungelesenen Bücher, die aus irgendeinem Grund noch nicht dran gekommen sind. Die Außenwelt wird mit dem eleganten Konsum-kritischen Satz abgetan: „Mir fällt nichts ein, was ich einkaufen könnte.“ (72)
Musil, Jorge Amado, Klaus Mann, Ernst Weiss, Sarraute, Lermontow, der durchgelesene Kanon entspricht einem literarischen Sittenbild der 68-er, die wie selten eine Generation zu einem Kanon der anerkannten Einheitsliteratur gefunden haben. Der lesende Anwalt interessiert sich vor allem für die Auswirkung der Lektüre auf das Wohlbefinden. Bei Becketts Molloy stellt er überrascht fest, dass es sich dabei fast um die eigene Geschichte handelt.
Am Schluss führt Fritz den Lesefreak noch einmal aus, es geht auf das Begräbnis eines Freundes. Bei Jean Paul schließlich brechen die Aufzeichnungen mitten im Siebenkäs ab.
In einem Nachspann übernimmt eine Studentin, die im Haus des Anwalts gewohnt hat, als Zufallserbschaft die Bibliothek und stößt dabei auf die Mitschrift des Dauerlesers. Die Anwältin lässt sich zu diesem niederösterreichischen Weltsatz hinreißen: „Bücher ohne Regale sind wie ein Gulasch ohne Knödel.“ (245)
Kann Lesen zur Sucht werden wie Alkohol oder Opium? Und müssten nicht auf Büchern Warnhinweise abgedruckt sein? – Der reflektierende Held ist sich der Auswirkungen des Lesens durchaus bewusst gewesen.
Helmut Rizys witziger Lektüre-Roman über einen Untergrundleser, der sich in eine Maulwurfshügel zurückgezogen hat, macht ungeheuer Lust, die Welt als Lese-Welt wahrzunehmen. Darin ist plötzlich alles sinnvoll in seiner unsterblichen Vergänglichkeit.
(Rezension: Helmuth Schönauer, Gegenwartsliteratur #1705)
https://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=149959&rezid=42703
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:
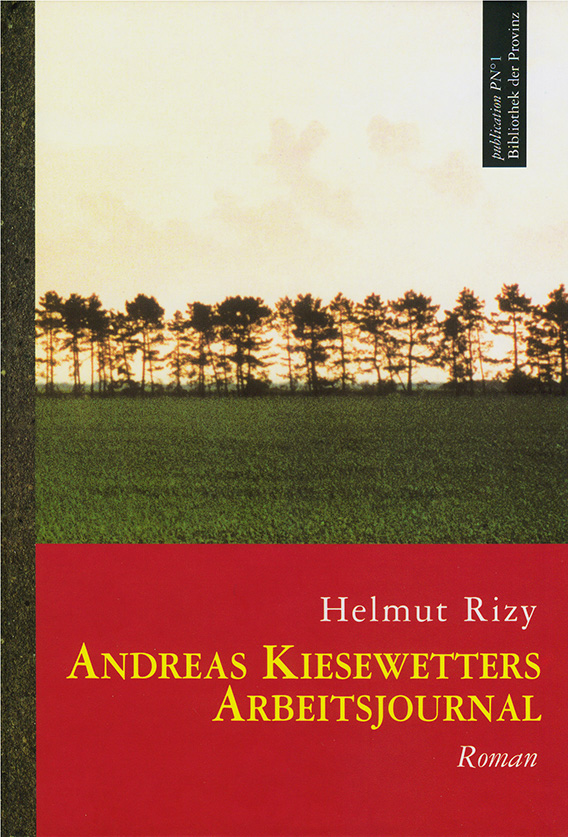
Andreas Kiesewetters Arbeitsjournal
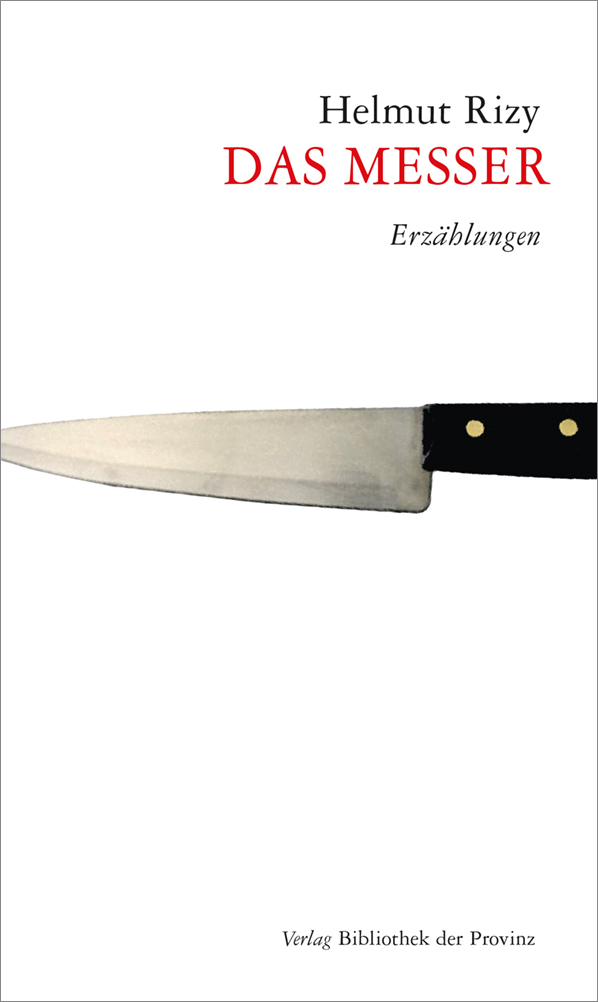
Das Messer

Hasenjagd im Mühlviertel
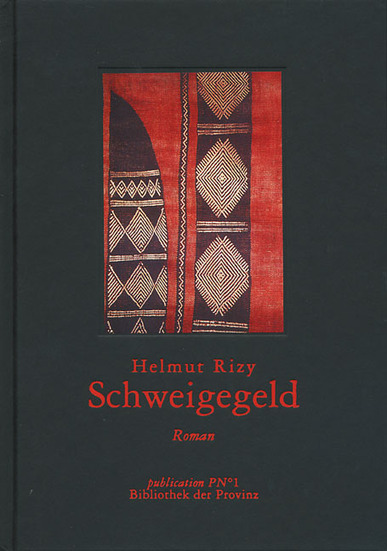
Schweigegeld
