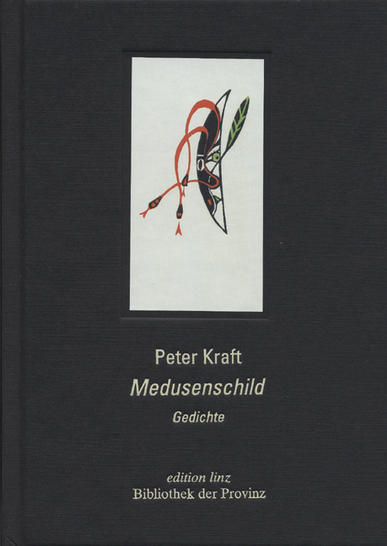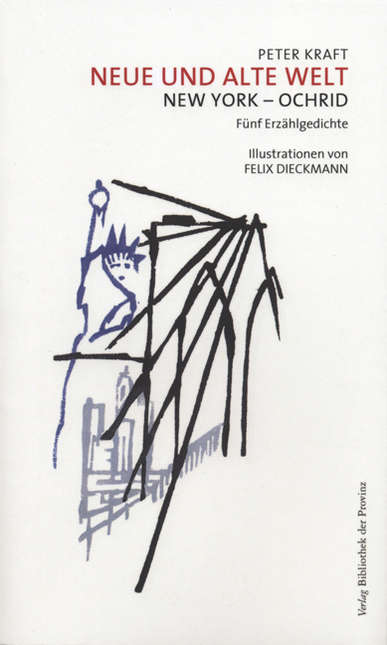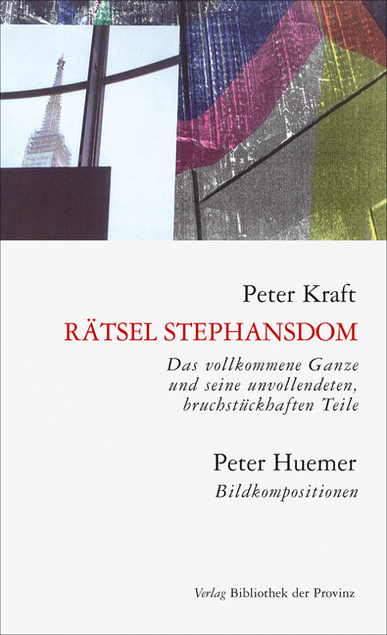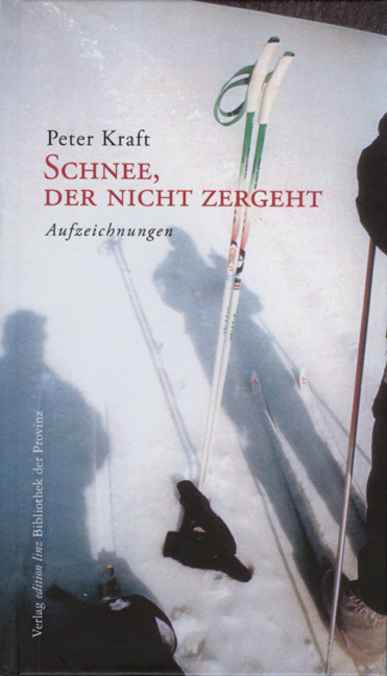
Schnee, der nicht zergeht
Aufzeichnungen
Peter Kraft
ISBN: 978-3-85252-777-2
21 x 13 cm, 236 S., Hardcover
€ 18,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Der Schisport – eine Naturfeindlichkeit
Der Sündenfall des alpinen Schilaufs im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts spiegelt sich in der zunehmenden Starre der Beine und Füße an den Schiern. Diese Bewegungslosigkeit ist zugleich entschiedene Entfernung von der Natur in die Künstlichkeit.
Es beginnt mit den technischen Aufstiegshilfen der Lifte, Gondeln und Bergbahnen. Damit engstens verbunden war und ist die Ausholzung riesiger Schneisen für die Pisten, immer öfter auch ein Grund für die Vermurung der Hänge, Verschüttung von Straßen. Horizont-weit wurden breitere, asphaltierte Zubringerstraßen zu riesigen Parkplätzen für tausende von Auto-Schi-Touristen und Urlauberbussen angelegt, welche die Hundertschaften der Schifahrer zu den Zielorten befördern.
Durch den Bergauftransport der Sportler gingen sowohl die Fähigkeit als auch der Gebrauch des autonomen Zu-Berge-Steigens fast zur Gänze verloren. Jene zahlenmäßig bescheidene Klientel, die den Tourenschilauf bis heute pflegt, nützt zumeist dennoch die technischen Aufstiegshilfen, um anschließend in desto höhere und einsamere Hochgebirgsgegenden fernab von den menschenübersäten Pisten vorzudringen. Dieser neue exponierte Tourenschilauf wiederum schädigt, wenn er rücksichtslos ausgeübt wird, die frisch gesetzten Jungwälder mit ihren im Tiefschnee versunkenen Trieben der nur fragmentarisch sichtbaren Bäumchen, er missachtet die Lawinengefahr und verstört das Wild, das sich gegenüber dem Lift- und Pistenbetrieb schon lange ins Ausgesetzte, Einsamere des Hochgebirges zurückgezogen hat.
Die mittels Schneekanonen und Raumgeräten, »Raupen«, präparierten Pisten haben eine Art des Schifahrens heraufbeschworen, die eine nähere Berührung mit dem Tief- und Wechselschnee der unbeeinträchtigten Schneelandschaft von vorneherein ausschließt. Die Pisten werden kilometerweit steil bergan aufgerissen, um die Rohrleitungen für die Wasserversorgung der Kunscschneekanonen aufzunehmen. Um die Rohre mit ihren zahlreichen Anschlüssen zu speisen, werden große, künstliche Wasserbecken über dem Karstgestein des Alpenkalks angelegt. Die Reinheit des Trinkwassers in den Häusern des Hochkessels und drunten im Ort an der Talsohle kann dadurch gefährdet sein, auch wenn die Landschaftsverplaner eine neue Entkeimungsanlage nach der ändern errichten. Der löchrige, höhlen- und kavernenreiche Karst ist ein perfektes Kommunikationssystem aller reinen und genauso der verunreinigten Wasseradern.
(Unvergesslich leider jener Nachmittag, an dem man auf einer früher unberührten Wiese mit riesigen, einzeln stehenden Fichten die Laster und Personengeländewagen mit Ketten an den Hinterrädern durch die aufgeweichten Schlammpisten sich hindurchpflügen sah, die einen mit den unförmigen, federnd baumelnden Plastikrohren auf der Ladefläche, die anderen dick mit Kot sich bespritzend, so dass Windschutzscheibe und Seitenfenster sich verfinsterten …)
Wie weit der sanfte Tourismus des Langlaufens und der autonom geplanten Tiefschnee-Touren mit Anstiegen und Abfahrten einen nur mit Quoten rechnenden Massenschisport künftig in die Schranken verweist, bleibt offen.
Feind der Naturnähe und -Verträglichkeit bleibt weiterhin ein Wirrschaftsdenken, das Produktion und Verkaufserfolge der heimischen Sportarrikelindustrie mit stets weiter zu maximierenden Gäsrezahlen zu koppeln sucht. Das Bild der durch Tourismus-Ballung verheerten Gebirgsorte spricht leider eine wenig erfreuliche Sprache.
Wie findet man aber zurück zum Anfang und wie hört man auf? Es ist wie ein Signal, nicht aufzugeben, ist wie die hartnäckige Bild-Erinnerung im Kopf, wenn der voll ausgerüstete Langläufer nach stundenlangem, dichtem Schneefall die tief verschneite Wiener Mariahilferstraße entlang stadteinwärts spurt. (Das Foto von diesem Mann ging vor Jahren durch die österreichische Tagespresse!)…
In zu einer Kette verknüpften persönlichen Fragmenten präsentiert sich ein Überblick über die Entwicklung des Schilaufs, über die Veränderung vom verlassenen Holzhaus in der Schneewüste zum modernen durchorganisierten Schizirkus.
Die Darstellungsweisen wechseln zwischen Diarium, Lyrik, Reflexionen, Essays und Erzählungen, je nach Zugang, den Peter Kraft zur winterlichen Fortbewegung findet. Er hat über fünfzig Jahre lang seine Erlebnisse, Empfindungen und Gedanken im Schnee aufgezeichnet und diese Erinnerungsstücke durch einen historischen Rückblick sowie literarische Funde ergänzt.
Ein Gespür für Schnee
Der 1935 geborene Autor wurde schon als Kind von seinen Eltern für den Wintersport begeistert, der in den dreißiger Jahren seinen ersten Popularitätsschub erlebte, allerdings noch lange vor dem Massentourismus, dessen problematische Auswirkungen Kraft immer wieder beklagt. Versunkene Bilder holt Peter Kraft wieder an die Oberfläche. Er erzählt von Schulskikursen, von Bergtouren, unter anderem auch von einer Skiwoche in Wagrain, wo in den fünfziger Jahren das Marketing-Produkt Karl Heinrich Waggerl zum touristischen Ortsbild gehörte. Anekdoten stehen neben Impressionen, auch in lyrischer Form, kritische Reflexionen (unter anderem zur Geschichte des Skisports) neben einfühlsamen Naturschilderungen. Die Menschenbilder bleiben eher skizzenhaft. Peter Kraft ist ein behutsamer Autor, der eher vorsichtig andeutet, als mit verbalem Zugriff attackiert. Aber unüberhörbar ist der elegische Ton eines Mannes, der weiß, dass der Schnee vergangener Jahre eben doch zergangen ist, dass die Erinnerung nie so ganz das Erlebnis ersetzen kann. Und was wird noch zu erleben sein in kommenden Wintern? „Wann ist er da, der Zeitpunkt des endgültigen Aufhörens und Aufhörenmüssens?“