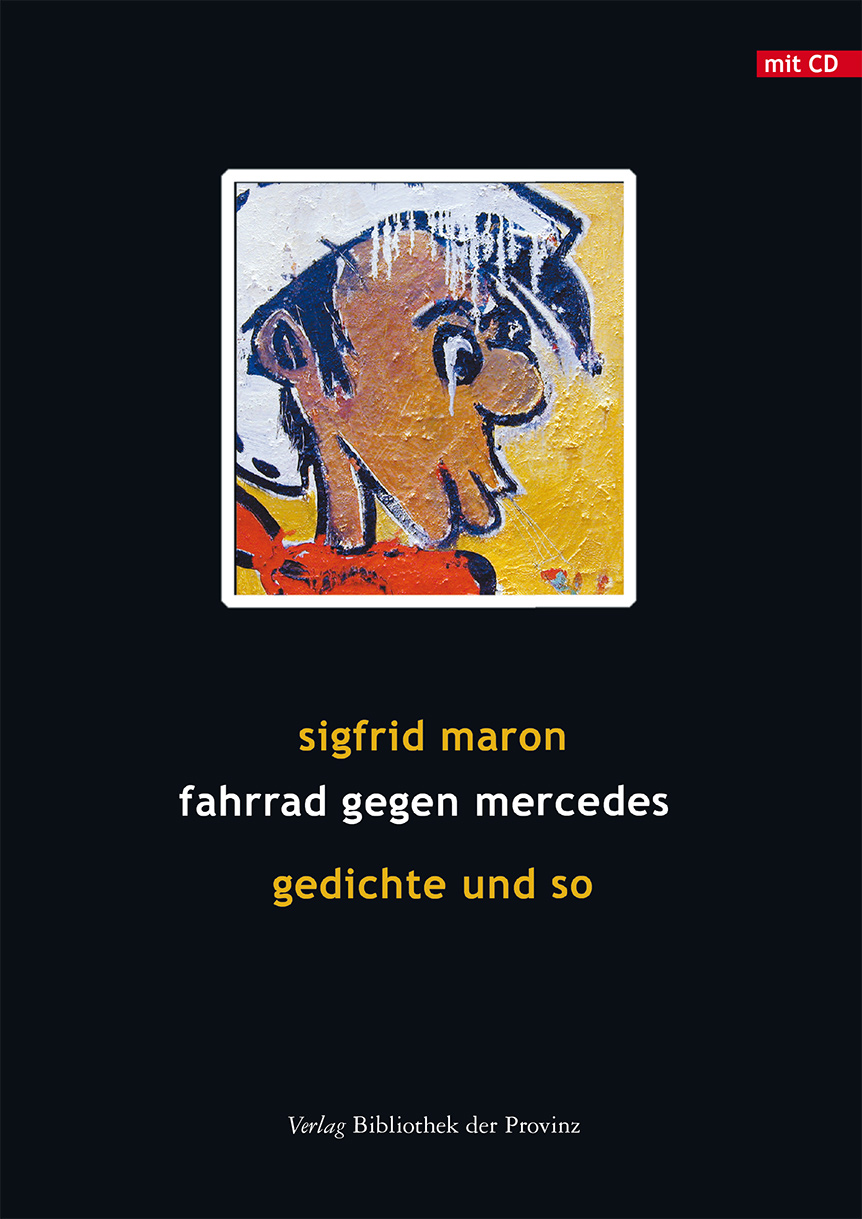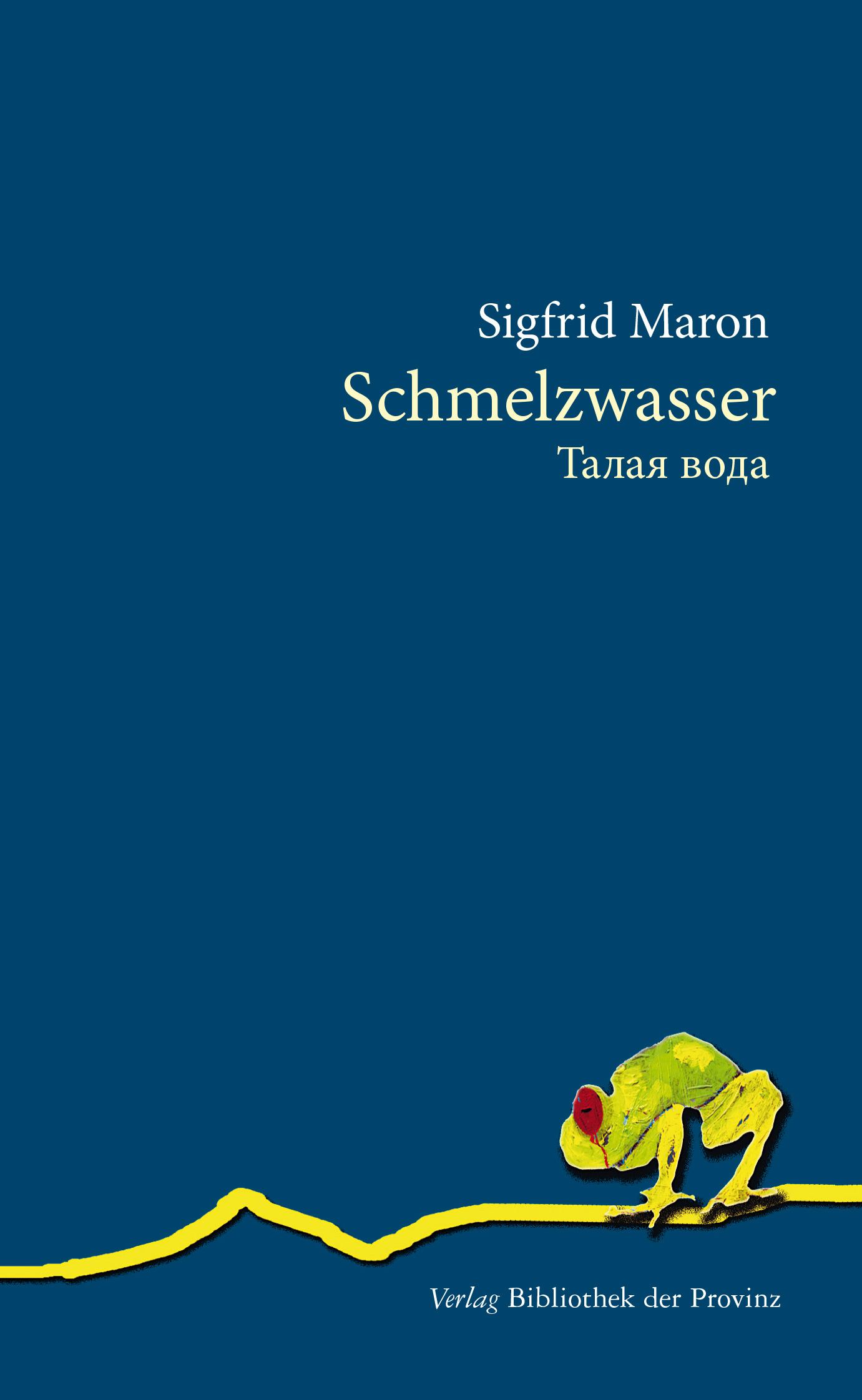
Schmelzwasser
[Eine Assoziationskette, möglicherweise ein Roman, keine Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine, aber fast ein Kochbuch]
Sigi Maron
ISBN: 978-3-85252-198-5
19 x 12 cm, 300 Seiten, m. Abb., Kt., Klappenbroschur
€ 24,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Das ist eine Geschichte, krumm und gebogen und frei erfunden, wie ja ein Großteil unserer Geschichte heute ver- oder zurechtgebogen, wenn nicht gleich völlig neu erfunden wird. Weder aus Sicht der Künstler, noch aus Sicht der Musikindustrie bzw. deren Mitarbeiter, von der Putzfrau bis hinauf zum Konzernchef, habe ich die geringste Ahnung von mehr oder minder. Was ich schreibe, habe ich gehört, gelesen, geträumt, fantasiert.
[Talaja voda, aus dem Weißruss. von Sergej Iljitsch Mladowskowitsch]
Rezensionen
Eva Jancak: [Rezension zu: Sigi Maron, „Schmelzwasser“]„Schmelzwasser“ von Sigfrid Maron ist, wie auf der Buchrückseite steht „krumm und gebogen und frei erfunden, wie ja ein Großteil unserer Geschichte heute ver- oder zurechtgebogen, wenn nicht völlig neu erfunden wird. Weder aus Sicht der Künstler, noch aus Sicht der Musikindustrie bzw. deren Mitarbeiter, von der Putzfrau bis hinauf zum Konzernchef, habe ich die geringste Ahnung von mehr oder minder. Was ich schreibe, habe ich gehört, gelesen, geträumt, fantasiert.“
Unter Autor und Titel auf der ersten Seite samt weißrussischer Übersetzung von Sergej Iljitsch Mladowskowitsch, steht noch, „eine Assoziationskette möglicherweise ein Roman keine Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine aber fast ein Kochbuch“, was sich wohl darauf bezieht, daß es auf den letzten Seiten ein paar Rezepte, wie Gulasch, Sauerkraut, Semmelknödel und Marillenkuchen gibt und beginnt, nach einigen Widmungen, einem Forwort (Achtung, bevor wieder eine Mahnung bezüglich meiner Rechtschreibung kommt, das ist im Buch so geschrieben und wird auch erklärt) und Erklärungen „mit quietschenden Reifen, Folgehorn und Blaulicht“ und einer Fahrt des Notarztwagens in ein Krankenhaus und endet fast, denn dann kommt noch eine Stellungnahme des Übersetzers, die Kochrezepte und auch schon die Rezensionen vom Schwarzataler Bezirksboten bis zur Furche und einer Seite Platz mit Gegendarstellungen, mit dem Erwachen aus der Narkose oder sonstigen Zuständen.
„Schlecht geträumt?“, fragt die Frau am Bett.
„Das war ein ganzes Buch, was macht nur solche Träume?“
„Das Abendessen!“, sagt Schwester Erika und hängt eine Literflasche Flüssignahrung an, „nur das Abendessen.“
Dazwischen liegen zweihundertfünfundachtzig Seiten, ein Paar Zeichnungen, in denen man beim russischen Finanzminister Alexej Kudrin, rein zufällig, weil das ja jede Ähnlichkeit, wie darunter steht, sein soll, Karl Heinz Grasser erkennt und zwei Handlungssträhne. Die eine ist ein wirrer Monolog, des auf der Intensivstation liegenden mit wahrscheinlich ebenfalls nur zufälligen Ähnlichkeiten zum Autor, Teile seiner Lebensgeschichte, wilde Fieberphantasien aber auch Betrachtungen zur politischen Lage, schwarz-blau, Asylpolitik, Kommunismus, Gott und die Welt etc, dann folgen Geschichten von seinem Taxi fahrenden Neffen, der ihm einen Werkzeugkasten verspricht und als Koch oder Kellner in einem seltsamen Hotel arbeitete. Der Ich-Erzähler kocht auch Sauerkraut etc und schreibt vielleicht an einem Roman über die Musikindustrie, in der er uns und das ist der zweite Strang, an dem Arsch bzw. Geschäftsführer Mike Peschl der Priestwein AG, die Auswirkungen der Globalisierung erklärt. Will Peschl doch die beste aller Sekretärinnen ficken und in der folgenden Mitarbeiterversammlung alle entlassen, einsparen, freisetzen, kündigen oder wie das in Neu Deutsch-Englisch so schön heißt heißt. Er kommt dann nicht in seine Wohnung hinein, stolpert über Leichen und einer seiner gekündigten Mitarbeiter tarnt mit der besten aller Sekretärinnen eine Geiselnahme und entkommt mit der ins Hotel Minsk in der Nezawisimosti-Alle 11.
Was es mit der weißrussischen Übersetzung auf sich hat, der Ich-Erzähler säuft bzw. kommuniziert immer wieder mit dem Übersetzter Mladi, der das im Dialekt geschriebene Buch zuerst auf weißrussisch und dann auf Hochdeutsch zurückübersetzt, habe ich nicht ganz verstanden, aber das kann man, wie ja schon im Vorwort steht, offenbar überhaupt nicht.
Das Buch ist also ein gigantischer Monolog, eine Fieberfantasie und Weltabrechnung eines kritischen Denkers, der möglicherweise oder auch nicht, großen Spaß am Vorsichhinfabulieren hatte, des 1944 in Wien geborenen, sozialkritischen Lidermachers Sigi Marons, der 1956 an Kinderlähmung erkrankte, sich 1997 aus gesundheitlichen Gründen zurückzog, einige Male für die KPÖ kanditierte und 2010 mit dem Doppelalbum „Es gibt kan Gott“ auf die Bühne zurückkehrte. Daraus habe ich ihm am Volksstimmefest singen und spielen gehört. Im November gab es in der Kunsthalle am Karlsplatz ein weiteres Konzert bzw. die Buchvorstellung, des in der Bibliothek der Provinz erschinenen „Schmelzwassers“, auf der Alfred war und mit das Buch zum Geburtstag schenkte Sigi Maron ist auch GAV Mitglied und so habe ich 1990 in einer von Georg Bydlinsky organisierten Lesung im Pfarrheim von Maria Enzersdorf, das Flugblatt hängt noch am Harlander Klo, mit ihm gelesen.
Ein interessantes Buch einer offenbar sehr selbstbewußten, kritischen Stimme, die offenbar keine Angst vor den kritischen Leserstimmen und deren Wutausbrüchen hat, sondern mit ihnen immer wieder direkt kommuniziert und gleich von vornherein feststellt, daß man das Buch nicht lesen muß.
Denn „es besteht keine generelle Vorschrift überhaupt Bücher zu lesen, ganz besonders nicht dieses“ und wie erwähnt, die Rezensionen hat er sich auch schon angefügt. So meint er, daß der Schwarzataler Bezirksbote meinen würde „Das ist kein Krimi und kein Roman, das ist Pornografie der schlimmsten Art. Solchen Autoren sollte man die Bleistifte wegnehmen, die Bleistiftspitzer natürlich auch.“
Tröstlich für die Rezensentin, die ja auch schon hörte, „daß sie sich nicht als solche nennen und auch nicht glauben sollte, daß sie schreiben darf weil sie es vielleicht ein bißchen kann, weil sie damit ja Ressourcen klaue und dem Betrieb schaden würde, aber wie!“
Der Unterschied zwischen meinen und Sigi Marons Texten ist vielleicht, daß ich es womöglich ernster meine, unsicherer bin und mich auch bemühe es meinen Kritikern recht zu machen oder auch nicht, was weiß man schon genau?
Ein interessantes Buch, daß ich allzu strengen Kritikern zur Lektüre sehr empfehlen kann. Man lernt dabei über den Tellerrand hinaus zu schauen. Wem das nicht gefällt, der kann sich ja an die Kochrezepte halten und „das und nicht der Gulasch“ dabei essen. Ein Achterl rot oder einen grünen Vetliner sollte man vielleicht dazu trinken.
(Eva Jancak, Rezension im weblog Literaturgeflüster veröffentlicht am 21. März 2011)
https://literaturgefluester.wordpress.com/2011/03/21/schmelzwasser/
Richard Weihs: Sigi Maron (1944–2016)
Jetzt ist auch der Sigi gestorben. Der Himmel samt Himmelvater hat ihm aber schon zu Lebzeiten gestohlen bleiben können. „Es gibt keinen Gott!“, hat er mit zarten 13 Jahren zu den geistlichen Schwestern im Wilhelminenspital gesagt, wo er wegen seiner Kinderlähmung behandelt wurde. es gibt kan gott heißt auch die CD, mit der er sich 2010 nach langer, krankheitsbedingter Abwesenheit wieder zurückmeldete. Es war damals eine große Freude, den Altmeister am Volksstimmefest eleben zu dürfen – noch dazu in Begleitung einer wilden, jungen Reggae-Band, den „Rocksteady-Allstars“.
Mich hat Sigi Maron mein ganzes Erwachsenenleben lang begleitet, beginnend vor 40 Jahren mit einem Auftritt in der legendären Schlachthof-Arena. Von da an war er überall anzutreffen, wo politisch etwas in Bewegung kam. Ich erinnere mich noch gut an seinen Auftritt bei der großen Anti-AKW-Demonstration in Zwentendorf: Ich sang den Götzzitat-Refrain seiner Ballade von ana hoatn Wochn begeistert mit – bis ich merkte, dass mich eine neben mir stehende Dame im Lodenköstum völlig entsetzt anstarrte.
Zur Zeit der Friedensbewegung in den frühen 80er-Jahren hat Sigi trotz seiner Behinderung ausgedehnte Tourneen durch Österreich und Deutschland absolviert und vor einem Riesenpublikum gespielt. Und obwohl er zu den prononciert kritischen Liedermachern zählte, hatte er vergleichsweise großen Erfolg – auch wenn er nicht zur Riege der kommerziell erfolgreichen Austro-Popstars zählte. Er selbst schrieb über seine Karriere:
„Zwölf Alben habe ich produzieren dürfen, ja dürfen, denn meine Lieder waren nicht das, was die Musikindustrie als Bestandteil der kapitalistischen Weltordnung haben will. Aufsässig, widerborstig, schwer verdaulich, mit dem Vokabular der Straße und viel zu direkt. Die Dinge beim Namen nennen, nicht blöd herumreden. Sicher keine Topseller, aber Longseller. Konzerte im ganzen deutschen Sprachraum. Totgeschwiegen im öffentlichen Rundfunk. Politisch angefeindet und ins Terroristeneck gestellt. … Ich bin kein Terrorist, nur ein genauer Beobachter, der seine Schlüsse zieht.“
Der Kommunist Maron hat abseits seiner öffentlichen Auftritte ein geordnetes Leben als Familienvater geführt und als EDV-Spezialist und Buchhalter gearbeitet. Und zwar bei jenem Plattenkonzern, bei dem er auch als Musiker unter Vertrag stand. Anlässlich seiner Kündigung im Zuge einschneidender Einsparungsmaßnahmen hat ein einen wehmütig-wütenden Abschiedsbrief geschrieben – eine beinharte Abrechnung mit dem menschenverachtenden Neoliberalismus.
Wütend waren auch viele seiner Protestlieder und Aktionen, wie seine legendäre Brunz-Attacke auf die Stufen des Wiener Funkhauses. Daneben gab es auch immer wieder nachdenkliche und zärtliche Lieder, die für mich (und viele andere) zu seinen Besten zählen. Und immerhin wurden nach langjährigem ORF-Boykott dann doch noch zwei dieser Lieder zu vielgespielten Hits.
Ein Jammer, dass sich Sigi nach seinem kurzen Comeback aus gesundheitlichen Gründen vor zwei Jahren endgültig von der Bühne verabschieden musste, und natürlich, dass er jetzt ganz von uns gegangen ist. Es bleibt die Erinerung an viele unvergessene Auftritte, solo, mit Band oder auch mit den ihn bewundernden Attwenger. Oder danach, wieich ihn einmal auf Klo im Keller des Albert-Schweitzer-Hauses getragen und mich gewundert habe, wie leicht dieses Schwergewicht der Liedermacherszene ist.
Einen Monat vor seinem Tod haben wir noch miteinander korrespondiert, wobei er so großzügig war, ein Gedicht von mir als „genial“ zu loben. Und weil er als Tohuwabohu-Blödler weitaus bekannter ist denn als Autor, möchte ich abschließend auf sein letztes Buch hinweisen:
Sigfrid Maron: Schmelzwasser. Aus dem Weißruss. v. Sergej Iljitsch Mladowskowitsch. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz [2010]. 298 S., Ill. €24,00. ISBN 978-3-85252-198-5.
Er hat dazu folgendes geschrieben:
„Schmelzwasser, die Geschichte einer Fusion, die Geschichte von dreißig Jahren Musikbusiness, die Geschichte von Ausgegrenzten, von aus politischen Gründen Totgeschwiegenen, die Geschichte von Gescheiten und Blöden, die Geschichte von Angepassten und Widerspenstigen, die Geschichte von Gutmenschen und Bösmenschen. Wird auch das Wort Gutmensch heute abfällig und abwertend verwendet, tausendmal lieber bin ich ein Gutmensch, als ein Bösmensch oder ein Blödmensch.“
(Richard Weihs, Nachruf erschienen in: Morgenschtean. Die österreiche Dialektzeitschrift, Nr. U50-51/2016, S. 5)
https://www.richardweihs.com/post/sigi-maron-1944-2016