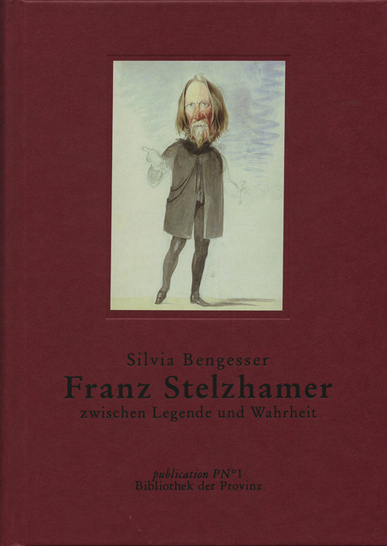
Franz Stelzhamer
zwischen Legende und Wahrheit ; Materialien zur Rezeption seiner Mundartdichtung 1837–1982
Silvia Bengesser, Franz Stelzhamer
ISBN: 978-3-85252-059-9
21 x 15 cm, 310 S., m. Abb., Hardcover
€ 22,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[Schriften zur Literatur und Sprache in Oberösterreich ; 4]
Meine Stelzhamer-Legende
Am Beginn möchte ich darstellen, wie ich dazu komme, eine Arbeit über die Rezeption der Mundartgedichte Franz Stelzhamers zu schreiben; beide, Leben und Werk, verschmelzen gerade bei diesem Dichter im Bewußtsein der Leser zu einer Einheit: spricht man von Franz Stelzhamer, meint man auch seine bekannten Gedichte; spricht man von seinen bekannten Gedichten, so schließt man auf das Gesamtwerk und auf die Person des Dichters.
Für die intensive Beschäftigung mit einem „Gegenstand“ ist immer auch Berührtsein und Liebe nötig. Diese sind für Franz Stelzhamer in meinen Kinder- und Jugendjahren geweckt worden. Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, haben mir zuerst von ihm erzählt: keine abgeschlossenen Geschichten, eher Geschichtenfetzen, Bruchstücke, die sich in mir zu einem Bild zusammengefügt haben. Wiederum kein scharfes Bild, eher verschwommen, doch mit einigen deutlich erkennbaren Linien – diese möchte ich mitteilen. Gesprochen wurde von ihm als einer zeitlosen Erscheinung: Es war einmal ein Mann, Stelzhamer geheißen, der wanderte die meiste Zeit im Innviertel herum. – Das Innviertel bestand damals für mich aus meinem Wohnort und ein paar Nachbardörfern und vor allem aus grünen Hügeln, Getreidefeldern, kleinen Wäldern und gewundenen Bächen; und er, der Mann, immer dazwischen, hügelaufhügelab, und vor allem immer in Bewegung. Manchmal rastete er in Gasthäusern, Brauereien und bei Bauern. Er trank viel Bier, unterhielt die Leute mit Liedern und Geschichten. Er tanzte viel und gerne, mochte die Frauen und sie mochten ihn. Er hatte nie Geld, und wenn er welches hatte, so verlor er es beim Karten- oder Kegelspiel. Er machte Schulden, d. h. er ließ in den Gasthäusern anschreiben und befreite sich von ihnen dadurch, daß er z. B. die volle Anschreibtafel einfach löschte.
Dieses anarchische Handeln brachte ihm Bewunderung, sogar vom geschädigten Wirt; häufig wurde er auch von den Gastwirten freigehalten wegen seiner Fähigkeiten als Unterhalter. Stand es ganz schlecht um ihn, so ging er heim zu seiner Mutter; diese soll sehr gütig gewesen sein – im Gegensatz zum strengen Vater steckte sie ihm immer wieder heimlich Geld zu, obwohl sie selbst kaum welches hatte.
Was sich mir über das Erzählte hinaus erschloß, war, daß es offensichtlich Menschen gibt, und sei es nur einer, die nicht arbeiten müssen, die über ihre Zeit frei verfügen und die tun, worauf sie Lust haben. Das Überraschendste dabei war: Sie überleben mit einer geradezu märchenhaften Leichtigkeit und werden für das Außergewöhnliche an ihrer Lebensweise bewundert, für das, was üblicherweise als Normüberschreitung bestraft wird. Was normalerweise als „Vagabundiererei“, als „Müßiggängertum“ und als „Tagedieb-Dasein“ verurteilt wurde, galt plötzlich als Ausdruck freien Menschentums.
Mit solchen Eigenschaften ausgestattet, paßte Franz Stelzhamer gut zu meinen Indianerphantasien. Später vergaß ich ihn. Viele Jahre danach sah ich ein Bild von ihm in seinem Geburtshaus in Großpiesenham: Stelzhamer als alter Mann mit langem Haar, zerfurchtem Gesicht und überaus wissenden Augen. Da war er wieder, der Indianer – und mit seinem Bild die ganze Faszination von damals. Von diesem Augenblick an wollte ich ihm nahekommen. Ich wollte soviel wie möglich über ihn erfahren, herausfinden, wer er wirklich war und was er geschrieben hatte außer der oberösterreichischen Landeshymne.
Meine Arbeit über Franz Stelzhamer betrachte ich bei aller nötigen wissenschaftlichen Genauigkeit auch als eine Entdeckungsreise durch ein Reich von Bildern und Vorstellungen, die sich im Laufe der Jahre über ihn und sein Werk gelegt haben.
