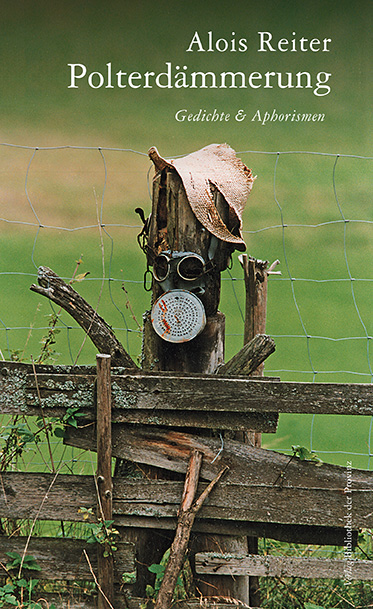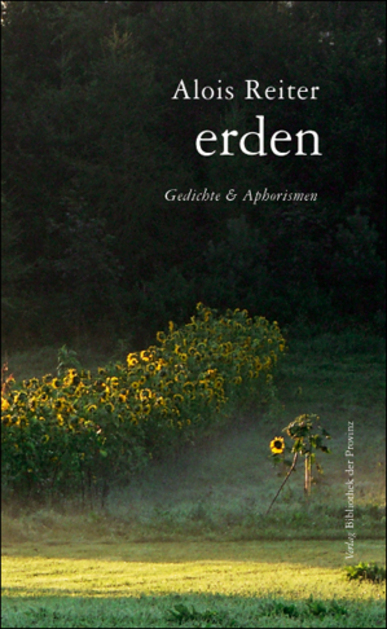
erden
Gedichte & Aphorismen
Alois Reiter
ISBN: 978-3-99028-219-9
21 x 12,5 cm, 72 S., Hardcover
13,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Reiters Gedichte wie Aphorismen sind unmittelbar aus dem tätigen Leben geschöpft, aus dem Leben eines kundigen Gärtners, im Mit-Erleben von Werden und Vergehen über die Jahre hinweg …
Im stummen Dialog mit den Dingen, die Verrücktheiten der Epoche reflektierend, entwickelt das Bewusstsein Gedankenspaziergänge. So ergeben sich Einfälle, Sprachspielereien, und aus der Metamorphose von Lektüre, Gedankenarbeit und Erfahrung singuläre Destillate. Satz- und Gartenbau gehen Hand in Hand.
Die Mutter starb
In ihrem Haus in Böhmen
Der Vater nahm im Krankenhaus
Sein letztes Bad
Der Tante ungeduldig Herz
Stand still am Gehsteig
In Onkels letztem Blick
War eine Kellnerin
Mein Vetter aß gerade
Sauren Fisch
Ich selber stürbe
Wenn's der Todesengel leidet
Recht willig angelehnt
Am alten Apfelbaum
Rezensionen
Reinhold Tauber: Früchtekorb aus dem NordlandDas Mühlviertel meldet sich mit schöner Literatur zu Wort
(…) Alois Reiter pflanzt Bäume, zieht Früchte unter ausschließlicher Nutzung des nicht mit Dünge-Kunst zusammengerührten Bodens. Er sitzt nachdenkend, nur halt unter seinen Obstbäumen, die gute Früchte tragen. Er hat Zeit, über die Welt nachzudenken, wie sie ist und wie sie sein sollte, auch die ihn umgebende geliebte Natur. Er hat Lesefrüchte gezogen, doch seine diesbezügliche Bekanntheit kam nicht weit über den Schatten seiner Fruchtbäume hinaus, was von manchen Beobachtern und Weggefährten bedauert wird, da das Management der Verlagswelt sich mit der Abnahme seiner Früchte zurückhält.
Die bewegte Vita Alois Reiters laut gestrafftem Eigenbericht: Landarbeiter, Praktikant, Rossknecht, Kraftfahrer im elterlichen Betrieb, Brotausführer, Barmusiker, Handelsreisender, Magazineur, technische Hilfskraft im Linzer Stadtmuseum Nordico, Musiklehrer für Akkordeon und Blockflöte an der Akademie der Diözese in Linz und an Musikschulen im Mühlviertel. Eigene Ausbildung: Bruckner-Konservatorium in Linz und Musikhochschule Wien. Daneben Studium von Öko-Gemüsebau, Anerkennung durch das Gütesiegel für ökologischen Landbau.
Nebenbei schreibt auch er seine Gedanken zur Welt und ihren Lauf nieder. Seit 45 Jahren kann er seine literarischen Früchtekörbe der Leser- und Hörerschaft anbieten, doch war und ist das Angebot knapp, mehr als fünf klein dimensionierte Bücher mit gutem Inhalt waren bisher nicht drin.
Nun ist er über 80, aber doch kein bisschen leise, vielleicht weiser geworden in der Beurteilung des Menschenwesens. Zum 80er hat Reiters jüngerer Weggefährte und Freund Richard Wall, eine Auswahl aus dessen Texten zusammengestellt: eine extrem komprimierte Übersicht über das lyrische Vermögen und die Fähigkeit geschliffener Aphoristik. Liebeserklärungen an das Land nördlich der Donau, Reflexionen dunkler Lebensstationen inklusive Krieg, über das Zerbröseln von Lebensordnungen, über Vergewaltigung der engeren und weiteren Umwelt. Das Buch ist klein, aber fein, ein Geburtstagsgeschenk, an dem auch andere teilhaben sollen als Leser. (…)
(Reinhold Tauber, Rezension in den Oberösterreichischen Nachrichten vom 31. Mai 2014)
Helmuth Schönauer: Alois Reiter, „Erden“
Literatur entsteht durchaus aus den unsichtbaren Rissen, die durch jede Gesellschaft verlaufen und an denen sich der Feinfühlige ansiedelt, um zu überleben.
Alois Reiter ist nach mannigfaltigen Berufen in der Stadt letztlich ins Mühlviertel aufgebrochen und zertifizierter Biobauer geworden. Zu einem Schlüsselerlebnis wird ihm jener unfreundliche Akt diverser Mitbewohner, die ihm eines Tages in Wurzelreichweite seines Biotops alte Asphalte von demontierten Straßen zu Füssen legen.
Diese Bedrohung im innigsten Lebensraum zieht sich wie ein roter Faden durch die Gedichte Alois Reiters, ob es sich um einen Einbruch des Todes in die Kindheit handelt, um das Zusammenkippen ganzer Landstriche bei Kriegsende oder um das Zusammenfallen liebgewonnener Lebensordnungen.
„Horch sagte die Schwester // Der Totenvogel schreit // Wir hockten eng / Am kalten Kachelofen // Der Nachtmahr schlich / Zur Tür herein // Wenn im Stall die Pferde stampften / Zitterte mit uns das Haus.“ (8)
Der Einzelne wird oft zerrissen in diesen Kräfteparallelogrammen, mal kann er die Kleidung nicht schnell genug wechseln, mal kommt er mit dem Kopf nicht nach.
„Totenvogel Taubenkleid // Langschattig Herz / Sturmgerissen / Den Waffenrock samt Orden // Schmiss der Soldat / In den Bach / Kriegsende Aufbruch / Zum kriegerischen Frieden.“ (15)
Einen Frieden, wenn es denn einen gibt, mit den Gewalten kann man nur im Einklang mit den Naturgesetzen finden, in diesem Reich der Jahreszeiten und Fruchtfolgen ist es auch nicht verpönt, ein demütiger Feldherr der Ähre zu sein.
„Feld der Ähre // Ein Feldherr bin ich / Feuerbohne Federbusch / Morgenperle Achselstück / Schreite kniebeug / Auf dem Feld der Ähre.“ (47)
In den Aphorismen sind diese Überlegungen für ein kantiges, im inneren Einklang ausgelegtes Leben zu straffen Botschaften gestaltet, die oft schroff sind wie ein Stück Rinde oder eingerollt wie eine Pflanze unterm Niederschlag.
„Beginne den Tag, sonst beginnt der Tag mit dir.“ / „Eine Hand wäscht die Andere – mit Schmierseife.“ / „Countdown läuft. Niemand zählt mit.“ / „Angst schwimmt gut im Alkohol.“
Und prophetisch über diese ausgespähte NATO-Gesellschaft: „Wir werden unsere Anonymität aufgeben müssen.“ (60)
Richard Wall beschreibt in seinem Nachwort die Lebens- und Arbeitsweise von Alois Reiter. Die Nähe zum Philosophen Thoreau ist unverkennbar, viele Gedichte greifen auf keltische Elemente zurück, wie sie in den irischen Naturgedichten vorkommen. Die Freundschaft zum Lyriker Michael Hamburger spielt eine entscheidende Rolle, und der Auftrag zum Schreiben geht vielleicht auf einen Brief aus dem Jahre 1966 von Max Brod zurück: „Ich möchte Ihnen Mut zurufen. Denken sie nicht im ‚understatement‘ von sich. Es war der einzige Fehler, den ich an Kafka gesehen und jahrelang bekämpft habe.“
So ist das aktive und passive „erden“ zur Grundvokabel des Alois Reiter geworden.
(Rezension: Helmuth Schönauer, Gegenwartsliteratur 2232, 16. April 2014)